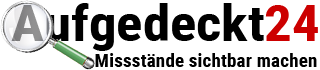Nebenkostenabrechnung erhalten – und erst mal geschluckt?
Viele zahlen klaglos, obwohl längst nicht alles umgelegt werden darf. Von Hausmeister bis Kabelanschluss: Ich zeige dir, welche Posten zulässig sind – und welche du guten Gewissens anzweifeln solltest. Plus: Mustervorlage für deinen Widerspruch.
Einleitung: Wenn aus Betriebskosten Abzocke wird
Die meisten Mieter kennen das Spiel: Irgendwann im Jahr kommt ein Umschlag vom Vermieter – oder gleich von der Hausverwaltung – mit dem Titel „Betriebskostenabrechnung“.
Drin steht, was im letzten Jahr so alles „für das Haus“ anfiel: Müllabfuhr, Wasser, Strom, Hausmeister, Gartenpflege, Winterdienst, Dachrinnenreinigung, Versicherungen, Kabelgebühren, Deichverband und am besten noch irgendwas mit „Sonstige Kosten“.
Und am Ende folgt dann meist das, was keiner gerne liest: eine deftige Nachzahlung.
Viele Mieter akzeptieren diese Abrechnung so, wie sie ist – aus Unwissen, Bequemlichkeit oder schlicht, weil sie glauben, „da kann man eh nichts machen“.
Aber genau hier liegt das Problem.
Denn nicht alles, was in so einer Abrechnung steht, darf auch wirklich abgerechnet werden. Und nicht selten zeigt sich bei genauerem Hinsehen:
Die Liste ist länger als nötig – und der Betrag höher als erlaubt.
Betriebskosten sind kein Freifahrtschein für Vermieter
Vermieter dürfen Betriebskosten nur unter bestimmten Bedingungen auf ihre Mieter umlegen:
- Sie müssen rechtlich zulässig sein
- Sie müssen im Mietvertrag vereinbart worden sein
- Und sie müssen belegt und nachvollziehbar sein
Aber wie sieht die Praxis aus?
Viel zu oft werden Kosten abgerechnet, bei denen fraglich ist, ob die Leistung überhaupt erbracht wurde. Oder ob sie überhaupt etwas in einer Betriebskostenabrechnung zu suchen hat. Besonders ärgerlich wird es dann, wenn:
- keine Belege vorgelegt werden
- auf Nachfragen nicht reagiert wird
- pauschal „Positionen“ zusammengerechnet werden, die nicht nachvollziehbar sind
In solchen Fällen ist Widerspruch nicht nur erlaubt, sondern dringend zu empfehlen.
Dieser Artikel klärt auf:
- Was laut Gesetz tatsächlich umgelegt werden darf
- Wo besonders häufig getrickst oder übertrieben wird
- Welche Rechte du als Mieter hast – und wie du sie durchsetzt
- Welche Urteile und Paragraphen dir dabei helfen
- Und wie du bei Bedarf mit einem formulierten Widerspruch reagieren kannst
Denn eines ist klar:
Wer blind zahlt, zahlt oft drauf.
Wer nachfragt, bekommt vielleicht keine Antwort – aber steht am Ende besser da.
Was Betriebskosten eigentlich sind – und was nicht
Wenn es um die monatliche Miete geht, spricht man oft von der „Warmmiete“. Diese setzt sich aus zwei Teilen zusammen:
- der Grundmiete (auch Nettokaltmiete) und
- den Betriebskosten (Nebenkosten)
Letztere sorgen immer wieder für Verwirrung – nicht nur wegen der jährlich schwankenden Nachzahlungen, sondern auch, weil viele Mieter gar nicht genau wissen, was der Vermieter überhaupt als Betriebskosten abrechnen darf – und was nicht.
Dabei ist das juristisch recht klar geregelt:
Betriebskosten sind laufende, regelmäßig wiederkehrende Kosten, die dem Eigentümer durch den Gebrauch des Gebäudes, Grundstücks oder der technischen Anlagen entstehen – und die nicht Reparaturen oder Verwaltung betreffen.
So steht es im Klartext in der Betriebskostenverordnung (BetrKV) und wird durch § 556 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) untermauert.
Klingt kompliziert? Kurz gesagt:
Betriebskosten = wiederkehrende Kosten für den laufenden Betrieb.
Keine Einmalaktionen, keine Reparaturen, keine Verwaltungskosten.
Was aber genau zu den umlagefähigen Betriebskosten gehört – und was nicht –, das schauen wir uns jetzt im nächsten Abschnitt an.
Gesetzliche Grundlage: § 556 BGB & Betriebskostenverordnung (BetrKV)
Die rechtlichen Grundlagen für Betriebskostenabrechnungen finden sich im deutschen Mietrecht, genauer gesagt in zwei zentralen Regelwerken:
- dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) – hier speziell § 556
- der sogenannten Betriebskostenverordnung (BetrKV)
Diese beiden Quellen regeln, ob, wie und was ein Vermieter überhaupt an Betriebskosten auf seine Mieter umlegen darf.
§ 556 BGB: Die Basis im Mietrecht
Der Paragraf § 556 BGB bildet den rechtlichen Rahmen für die Vereinbarung und Abrechnung von Betriebskosten im Mietvertrag. Dort heißt es unter anderem:
„Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass der Mieter Betriebskosten trägt.“
(§ 556 Abs. 1 Satz 1 BGB)
Wichtig: Ohne vertragliche Vereinbarung darf der Vermieter keine Betriebskosten abrechnen.
Ein Hinweis im Mietvertrag wie „Die Betriebskosten trägt der Mieter gemäß Betriebskostenverordnung“ reicht aber bereits aus, um die gesetzlich definierten Kostenarten umzulegen.
Ebenfalls geregelt in § 556 BGB:
- die Pflicht zur jährlichen Abrechnung
- die 12-Monatsfrist (siehe später)
- die Rechtsfolgen bei Fristversäumnis
Die Betriebskostenverordnung (BetrKV)
Die Betriebskostenverordnung (BetrKV) listet in § 2 genau auf, welche Arten von Kosten als umlagefähige Betriebskosten gelten.
Dazu zählen z. B.:
- Wasserversorgung
- Heizung
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Hausreinigung
- Gartenpflege
- Beleuchtung
- Hausmeister
- Gebäudeversicherung
- Schornsteinfeger
- Kabel- und Antennenanlagen
- usw.
Insgesamt sind es 17 Nummern mit teils sehr weit gefassten Unterpunkten.
Wichtig: Die BetrKV ist abschließend – das heißt,
andere Betriebskostenarten sind nur dann umlagefähig, wenn sie gleichartig und im Mietvertrag genannt sind.
Kein Spielraum für Fantasieposten
Immer wieder tauchen in Betriebskostenabrechnungen Posten auf, die dort nichts zu suchen haben – z. B.:
- Verwaltungskosten
- Reparaturen
- Sperrmüll nach Zwangsräumungen
- Kosten für Mahnwesen
- „Sonstige Dienstleistungen“, die nicht weiter erläutert werden
Solche Positionen sind nicht durch die BetrKV gedeckt – und daher nicht umlagefähig.
Fazit:
- Betriebskosten dürfen nur auf Grundlage einer Mietvertragsvereinbarung abgerechnet werden.
- Maßgeblich ist die Betriebskostenverordnung (BetrKV) in Verbindung mit § 556 BGB
- Alles, was nicht in der BetrKV steht oder nicht vertraglich vereinbart wurde, darf nicht auf Mieter umgelegt werden – selbst wenn es im Alltag des Hauses eine Rolle spielt.
Pauschale oder Abrechnung – was ist erlaubt?
Bei der Frage, wie Betriebskosten zwischen Vermieter und Mieter geregelt werden, gibt es zwei grundsätzliche Modelle:
- die Betriebskostenpauschale
- die Betriebskostenvorauszahlung mit jährlicher Abrechnung
Beide Varianten sind zulässig – aber sie unterscheiden sich deutlich in ihren Folgen für beide Seiten. Welche Form Anwendung findet, muss explizit im Mietvertrag vereinbart sein.
1. Die Betriebskostenpauschale
Bei einer Pauschale zahlt der Mieter einen festen monatlichen Betrag, der alle Betriebskosten abdeckt – ohne spätere Abrechnung.
Das heißt:
- Es gibt keine Nachzahlung, aber auch kein Guthaben bei Minderverbrauch.
- Der Betrag ist unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch.
Beispiel:
Der Mietvertrag sagt: „Die Betriebskosten betragen pauschal 80 € monatlich.“
→ Dann ist das ein fester Betrag, mit dem der Vermieter sämtliche Betriebskosten abdecken muss – ohne spätere Nachforderung.
Vorteil für Mieter: Planungssicherheit, kein böses Erwachen durch Nachzahlungen
Nachteil: Keine Rückzahlung bei niedriger Nutzung, z. B. bei urlaubsbedingter Abwesenheit oder sehr geringem Verbrauch
⚠️ Wichtig:
Die Pauschale muss im Mietvertrag ausdrücklich als solche bezeichnet werden.
Wenn dort steht „Vorauszahlung auf Betriebskosten“, handelt es sich nicht um eine Pauschale.
Hinweis zum Leerstand:
Ob andere Wohnungen leer stehen, ist für Mieter mit Pauschale ohne Relevanz.
Sie zahlen immer denselben Betrag – unabhängig davon, wie viele Nachbarn vorhanden sind oder wie hoch die Gesamtkosten tatsächlich ausfallen.
Nur für den Vermieter kann Leerstand bei Pauschale finanziell nachteilig sein, da er weniger Pauschalzahlungen einnimmt.
2. Die Betriebskostenvorauszahlung mit jährlicher Abrechnung
Dies ist die häufigste Regelung.
Dabei zahlt der Mieter monatliche Abschläge auf die Betriebskosten – basierend auf einer Schätzung oder Vorjahreswerten.
Am Jahresende erfolgt dann eine exakte Abrechnung über die tatsächlich entstandenen Kosten.
Beispiel:
Der Mietvertrag sagt: „Der Mieter leistet monatlich 100 € Betriebskostenvorauszahlung. Es erfolgt eine jährliche Abrechnung.“
→ Dann kann es zu Nachzahlungen oder Guthaben kommen – je nachdem, wie hoch die tatsächlichen Kosten ausfielen.
Vorteil für Mieter: Transparenz, gerechte Verteilung nach Verbrauch
Nachteil: Unsicherheit über Nachzahlung, besonders bei Preisanstieg oder Zusatzkosten
Hinweis
Die Abrechnung muss spätestens 12 Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums zugehen (siehe § 556 Abs. 3 BGB) – sonst verfallen etwaige Nachforderungen des Vermieters.
Wichtige Unterschiede im Überblick
| Merkmal | Pauschale | Vorauszahlung mit Abrechnung |
|---|---|---|
| Monatlicher Betrag | Festbetrag | Abschlag (Schätzung) |
| Nachzahlung möglich? | ❌ Nein | ✅ Ja |
| Guthaben möglich? | ❌ Nein | ✅ Ja |
| Abrechnung erforderlich? | ❌ Nein | ✅ Ja, jährlich (§ 556 BGB) |
| Anpassung durch Vermieter? | Nur mit neuer Vereinbarung | Automatisch nach Abrechnung (§ 560 BGB) |
Was gilt, wenn im Mietvertrag nichts geregelt ist?
Fehlt im Mietvertrag jegliche Regelung zu Betriebskosten, gilt nach § 556 BGB:
„Betriebskosten können nur verlangt werden, wenn dies vereinbart wurde.“
→ Dann muss der Mieter überhaupt keine Betriebskosten zahlen – auch nicht rückwirkend.
Fazit:
- Nur bei einer Pauschale darf auf eine Abrechnung verzichtet werden.
- Vorauszahlungen erfordern eine jährliche Abrechnung – mit Fristen, Belegpflicht und Nachvollziehbarkeit.
- Die Abrechnungsform muss eindeutig im Mietvertrag geregelt sein.
Form & Frist: Wie und wann muss die Abrechnung zugestellt werden?
Die gesetzliche Grundlage
Laut § 556 Abs. 3 BGB ist der Vermieter verpflichtet, dem Mieter jährlich eine Betriebskostenabrechnung zu erstellen, wenn Vorauszahlungen vereinbart wurden.
Diese Abrechnung muss dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des 12. Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums zugehen.
Beispiel:
- Die Abrechnung betrifft das Jahr 2023
- Dann muss sie bis spätestens zum 31.12.2024 zugestellt werden
Wird diese Frist verpasst, hat das Konsequenzen:
Nachzahlungen sind dann ausgeschlossen.
Der Mieter muss nur noch zahlen, wenn er selbst die Verzögerung verschuldet hat (z. B. wichtige Unterlagen nicht geliefert).
Die richtige Zustellungsform
Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, dass eine Abrechnung per Post geschickt werden muss – aber sie muss nachweisbar zugehen.
Zulässige Zustellarten (wenn der Mieter zustimmt):
- Per Post (Brief)
- Persönliche Übergabe mit Empfangsbestätigung
- Per E-Mail (z. B. als PDF-Datei)
- Über Online-Mieterportale, sofern der Zugang funktioniert und bekannt ist
Fragwürdige Varianten:
- WhatsApp, SMS oder Messenger-Dienste
– Diese gelten nicht als verlässlicher, rechtssicherer Übertragungsweg
– Kein Nachweis über Zugang und dauerhafte Lesbarkeit
– Nur zulässig, wenn der Mieter ausdrücklich damit einverstanden ist – und auch dann: rechtlich umstritten
Wichtig für Mieter:
- Wenn die Abrechnung zu spät kommt oder nicht korrekt zugestellt wurde, sollte man das dokumentieren und schriftlich widersprechen.
- Auch bei digitaler Zustellung sollte man immer prüfen:
- Wurde die Abrechnung tatsächlich zugestellt oder nur angekündigt?
- Ist der Versandzeitpunkt belegbar?
- Ist die Datei lesbar, vollständig und dauerhaft speicherbar?
Fazit:
Die Betriebskostenabrechnung muss rechtzeitig (bis 31.12. des Folgejahres) und nachvollziehbar zugestellt werden.
Wer seine Abrechnung nur als WhatsApp-PDF ohne Zustimmung oder Nachweis bekommt, hat gute Chancen, eine Nachzahlung abzulehnen.
Welche Betriebskosten grundsätzlich umlegbar sind
Viele Mieter staunen nicht schlecht, wenn sie ihre jährliche Betriebskostenabrechnung in den Händen halten – und dann Posten wie „Gartenpflege Baumpflege“, „Hauswart“, „Deichverband“ oder „Dachrinnenreinigung“ auftauchen. Noch erstaunlicher wird es, wenn sich solche Kosten jedes Jahr wiederfinden – obwohl die angeblichen Leistungen kaum sichtbar oder zweifelhaft sind.
Aber was darf der Vermieter eigentlich auf die Mieter umlegen – und was nicht?
Die Antwort liefert die Betriebskostenverordnung (BetrKV). Dort ist in § 2 ganz genau aufgelistet, welche Nebenkostenpositionen umlagefähig sind – und welche eben nicht.
Gesetzlich geregelt – aber auslegungsbedürftig
Die BetrKV benennt in § 2 insgesamt 17 klar definierte Betriebskostenarten, die abgerechnet werden dürfen – aber nur, wenn sie im Mietvertrag ausdrücklich genannt oder zumindest sinngemäß erfasst sind.
Alles, was nicht unter diese gesetzlich erlaubten Betriebskosten fällt, ist nicht umlagefähig – und muss vom Vermieter selbst getragen werden.
Typische nicht umlegbare Kosten (die also nicht in die Abrechnung gehören), sind zum Beispiel:
- Verwaltungskosten (z. B. Büromaterial, Gehälter der Verwaltung, Porto)
- Reparaturen und Instandhaltung (z. B. defekte Türschlösser, kaputte Heizkörper, Malerarbeiten)
- Rücklagen für Modernisierungen
- Finanzierungskosten (z. B. Kreditzinsen für die Immobilie)
- Rechts- oder Gerichtskosten
- Kosten durch Leerstand
Trotzdem versuchen manche Vermieter, solche nicht umlagefähigen Posten in der Abrechnung unterzubringen – gerne unter Sammelbegriffen wie „Sonstige Betriebskosten“, „Hausbetreuung“ oder „Servicepauschale“. Und genau hier wird es kritisch.
Ziel dieses Kapitels:
In den folgenden Abschnitten schauen wir uns alle 17 gesetzlich anerkannten Betriebskostenarten genau an – mit Beispielen, möglichen Streitpunkten, Gerichtsurteilen und der Frage:
„Was darf wirklich abgerechnet werden – und was ist fragwürdig, überhöht oder schlicht unzulässig?“
Liste zulässiger Betriebskostenarten laut § 2 BetrKV
Die zentrale rechtliche Grundlage dafür, welche Betriebskosten auf Mieter umgelegt werden dürfen, ist die Betriebskostenverordnung (BetrKV).
Dort ist in § 2 genau definiert, was unter „Betriebskosten“ im mietrechtlichen Sinne zu verstehen ist.
Diese Liste umfasst 17 zulässige Kostenarten – mehr nicht.
Alle weiteren Kostenarten, die darüber hinausgehen, sind nicht umlagefähig, auch wenn sie vom Vermieter kreativ umetikettiert werden.
Was sagt § 2 BetrKV genau?
„Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer (…) laufend entstehen.“
Das umfasst z. B. Steuern, Reinigung, Heizung, Müllabfuhr – aber keine Reparaturen oder Verwaltungskosten.
Die 17 umlagefähigen Betriebskostenarten im Überblick:
| Nr. | Betriebskostenart | Typische Beispiele | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Grundsteuer | Grundabgabe an die Stadt/Gemeinde | Muss im Mietvertrag stehen |
| 2 | Wasserversorgung | Trinkwasser, Wasserzähler, Grundgebühren | Kein Warmwasser! |
| 3 | Entwässerung | Abwasser, Regenwassergebühren | Achtung bei versiegelten Flächen |
| 4 | Heizung | Brennstoffkosten, Wartung, Ablesung | Nur, wenn zentrale Heizungsanlage |
| 5 | Warmwasserversorgung | Erhitzung, Wartung, Energie | Nur zentrale Anlagen – nicht Boiler in der Wohnung |
| 6 | Heizung & Warmwasser kombiniert | Kombinierte Abrechnung bei zentraler Anlage | Sonderregelung gemäß § 9 HeizkostenV |
| 7 | Aufzug | Wartung, Notruf, Energie | Nur bei Nutzungsmöglichkeit |
| 8 | Straßenreinigung & Winterdienst | Öffentliche & private Wege | Vorsicht bei seltenem Einsatz! |
| 9 | Müllbeseitigung | Tonnenentleerung, Gebühren | Keine Sperrmüllkosten ohne Vorankündigung |
| 10 | Gebäudereinigung & Ungezieferbekämpfung | Treppenhaus, Keller, Dachböden | Nur laufende Reinigung, keine Sonderaktionen |
| 11 | Gartenpflege | Rasen, Hecken, Spielplätze | Pflege ja – Neuanlage nein! |
| 12 | Beleuchtung | Strom für Flure, Keller, Außenlampen | Kein Wohnungsstrom! |
| 13 | Schornsteinfeger | Kehrgebühren, Messungen | Keine Zusatzarbeiten wie Reparaturen |
| 14 | Versicherungen | Gebäude- & Haftpflichtversicherung | Keine Hausrat- oder Rechtsschutzversicherung |
| 15 | Hauswart/Hausmeister | Wartung, Kontrolle, Reinigung | Kein Winterdienst, keine Verwaltungstätigkeit |
| 16 | Gemeinschaftsantennen/Kabelanschluss | Betriebs- und Wartungskosten | ⚠️ Seit Juli 2024 nicht mehr automatisch umlagefähig – siehe Kapitel 3.16 |
| 17 | Sonstige Betriebskosten | z. B. Wartung von Rauchmeldern | Nur zulässig, wenn einzeln benannt im Mietvertrag! |
Wichtig zu wissen:
- Nur was ausdrücklich im Mietvertrag vereinbart ist, darf umgelegt werden.
- Die 17 Positionen dürfen nicht einfach pauschal abgerechnet werden, sondern müssen nachvollziehbar belegt sein.
- Die Kategorie „Sonstige Betriebskosten“ ist kein Freifahrtschein – hier muss ganz konkret im Mietvertrag benannt sein, was gemeint ist (z. B. Wartung von Feuerlöschern, Dachrinnenreinigung etc.).
Tipp für Mieter:
Wenn in deiner Abrechnung Positionen auftauchen wie:
- „Servicepauschale“
- „Verwaltungskosten“
- „Sonderreinigung“
… lohnt sich ein genauer Blick. Diese Begriffe tauchen nicht in der BetrKV auf und sind meist nicht umlagefähig.
Was der Mietvertrag regeln muss
Damit ein Vermieter überhaupt Betriebskosten auf den Mieter umlegen darf, braucht es eine klare vertragliche Grundlage. Einfach auf Verdacht oder „weil man das halt so macht“ reicht nicht. Und genau hier liegt der erste häufige Fehler: Nicht alles, was in der Abrechnung steht, ist automatisch erlaubt.
Ohne Vereinbarung – keine Umlage
Gemäß § 556 Abs. 1 BGB gilt:
„Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass der Mieter Betriebskosten trägt.“
Heißt im Klartext: Nur wenn es im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart wurde, darf der Vermieter Betriebskosten umlegen.
Fehlt diese Regelung, muss der Mieter gar keine Betriebskosten zahlen, auch wenn sie real anfallen.
Welche Formulierungen sind zulässig?
Es reicht, wenn im Mietvertrag etwa steht:
- „Die Betriebskosten werden gemäß § 2 BetrKV auf den Mieter umgelegt.“
- Oder: „Der Mieter trägt die Betriebskosten gemäß der anliegenden Betriebskostenliste.“
Achtung bei schwammigen Aussagen wie:
- „Betriebskosten werden anteilig berechnet.“
→ Unklar und rechtlich angreifbar.
Was muss genau aufgeführt sein?
Der Mietvertrag sollte entweder:
- alle Betriebskostenarten einzeln aufführen
oder - auf die Betriebskostenverordnung (BetrKV) verweisen (z. B. „gemäß § 2 BetrKV“)
Nicht zulässig ist es, später einfach Posten hinzuzufügen, die nicht im Vertrag stehen – z. B.:
„Sonstige Kosten“, „Servicepauschale“ oder „Kabelanschluss“ (nach 2024), wenn das nie vereinbart wurde.
Vorsicht bei „Sonstige Betriebskosten“
Die BetrKV nennt 17 Arten von Betriebskosten – Nr. 17 davon lautet:
„Sonstige Betriebskosten, insbesondere …“
Damit meint der Gesetzgeber z. B. Dinge wie:
- Wartung von Rauchmeldern,
- Dachrinnenreinigung,
- Kosten für Blitzschutzanlagen.
Aber auch hier gilt:
Nur erlaubt, wenn im Mietvertrag ausdrücklich benannt!
Eine bloße Pauschalformel wie „…sowie sonstige Betriebskosten“ genügt nicht.
Dein gutes Recht als Mieter
- Du darfst jederzeit eine Kopie des Mietvertrags und der Betriebskostenvereinbarung anfordern, wenn dir keine vorliegt.
- Wenn neue Kostenarten auftauchen (z. B. „Sicherheitsdienst“, „Servicepauschale“), verlange schriftlich den Nachweis, wo genau dies im Mietvertrag steht.
Merke:
- Ohne klare Vereinbarung keine Umlage!
- Die Betriebskosten müssen im Mietvertrag konkret oder per Verweis auf die BetrKV benannt sein.
- Änderungen oder Erweiterungen benötigen deine Zustimmung – sie können nicht einfach einseitig vom Vermieter eingeführt werden.
Grundsteuer
Die Grundsteuer gehört zu den klassischen Betriebskosten, die grundsätzlich umlagefähig sind. Das heißt: Vermieter dürfen diesen Posten auf die Mieter umlegen – aber auch hier gilt: nur unter bestimmten Voraussetzungen und nicht in beliebiger Höhe.
Was ist die Grundsteuer überhaupt?
Die Grundsteuer ist eine kommunale Steuer, die für den Besitz von Grundstücken und Gebäuden anfällt.
Sie wird von den Städten und Gemeinden erhoben und fließt in deren Haushalt – also zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben wie Straßenbau, Schulen oder Grünpflege.
Es gibt zwei Varianten:
- Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen
- Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke in Städten – also für Mietwohnungen relevant
Umlage über die Betriebskosten
Die Betriebskostenverordnung (BetrKV) nennt die Grundsteuer in § 2 Nr. 1 ausdrücklich als umlagefähige Position. Voraussetzung ist, dass dies im Mietvertrag vereinbart wurde – entweder pauschal über die BetrKV oder direkt als Einzelposten.
Was heißt das konkret?
Die Grundsteuer wird anteilig auf die Mieter umgelegt – meist im Verhältnis zur Wohnfläche.
Bei einem Haus mit 10 Parteien zahlt also jeder ein Zehntel (oder entsprechend der Quadratmeterzahl).
Worauf Mieter achten sollten
Auch wenn die Umlage an sich erlaubt ist – prüfen lohnt sich trotzdem, denn hier wird oft getrickst oder geschlampt:
1. Angemessene Höhe?
- Die Grundsteuer ist keine Phantasiezahl.
- Grundlage ist ein Hebesatz, den jede Gemeinde selbst festlegt – z. B. 350 % oder 490 % auf den sogenannten Einheitswert.
- Diese Werte sind öffentlich einsehbar auf der Website deiner Stadt oder Gemeinde.
- Die tatsächliche Jahreszahlung des Vermieters an das Finanzamt muss der Abrechnung zugrunde liegen – nicht irgendein geschätzter Betrag.
➡️ Tipp: Fordere Einsicht in den Grundsteuerbescheid der Stadt, falls dir die Summe verdächtig vorkommt.
2. Leerstand oder gewerbliche Nutzung
- Leerstehende Wohnungen dürfen nicht anteilig auf die übrigen Mieter umgelegt werden – der Vermieter trägt diesen Anteil selbst.
- Auch gewerbliche Einheiten müssen getrennt behandelt werden, wenn sie im Haus sind.
3. Fehlende oder ungenaue Aufschlüsselung
- In manchen Abrechnungen wird einfach „Grundsteuer“ als Pauschalbetrag genannt – ohne Nachweis.
- Dabei hast du das Recht auf eine konkrete Angabe deiner Wohnfläche, des Gesamthauses und der tatsächlichen Steuerzahlung.
Wichtig zu wissen:
- Ab dem Jahr 2025 tritt bundesweit die Grundsteuerreform in Kraft. Dann wird die Berechnung auf neue Grundlagen gestellt (je nach Bundesland unterschiedlich).
Die Folge: Erhöhte Transparenzpflichten – aber auch mögliche Kostensteigerungen, auf die Vermieter reagieren könnten.
Fazit:
Die Grundsteuer darf umgelegt werden – aber nur in tatsächlicher Höhe und transparent.
Wenn dir etwas seltsam vorkommt, verlange den Grundsteuerbescheid. Du musst nicht zahlen, was nicht nachgewiesen werden kann.
Wasserversorgung
Wasser ist lebensnotwendig – und genau deshalb ein klassischer Bestandteil der Betriebskosten. Doch auch bei diesem scheinbar harmlosen Posten lohnt sich ein zweiter Blick, denn nicht immer ist die Abrechnung korrekt oder nachvollziehbar.
Was gehört zur „Wasserversorgung“?
Die Betriebskostenverordnung zählt in § 2 Nr. 2 BetrKV die Wasserversorgung als umlagefähigen Posten auf.
Dazu gehören:
- Die Kosten für den Bezug von Frischwasser vom örtlichen Wasserversorger
- Grundgebühren für Wasserzähler
- Miet- und Wartungskosten für Wasserzähler (wenn vertraglich vereinbart)
- Kosten für die Nutzung und Wartung der hauseigenen Wasserversorgungsanlage (falls vorhanden)
Nicht umlagefähig sind hingegen:
- Reparaturkosten an Leitungen, Armaturen oder defekten Wasserzählern
- Investitionen in neue Zähler oder Rohre
- Rücklagen für Sanierungen
Abrechnung nach Verbrauch – oder pauschal?
Die Abrechnung erfolgt idealerweise nach tatsächlichem Verbrauch, gemessen durch Wohnungswasserzähler.
Ist kein Zähler vorhanden, darf auch nach Wohnfläche oder Personenzahl umgelegt werden – allerdings nur, wenn keine Verbrauchserfassung möglich oder zumutbar ist.
Wichtig:
Seit 2021 gilt für viele Vermieter durch die Heizkostenverordnung (HKVO) auch für Warmwasserzähler die Pflicht zur fernauslesbaren Verbrauchserfassung – doch das betrifft Warmwasser, nicht das hier behandelte Kaltwasser.
Worauf Mieter achten sollten
1. Verbrauch plausibel?
Wenn du alleine wohnst, aber der Verbrauch dem einer vierköpfigen Familie entspricht, sollte man stutzig werden.
Auch plötzliche Schwankungen von Jahr zu Jahr ohne Veränderung im Haushalt sind ein Warnsignal.
Tipp: Vergleiche die Abrechnung mit den eigenen Ablesewerten oder früheren Jahren.
2. Kosten im Vergleich zu Versorgerpreisen
Die Kosten für Frischwasser und Abwasser sind öffentlich einsehbar, z. B. auf der Website deines Stadtwerks.
Wenn der Preis pro Kubikmeter in der Abrechnung deutlich höher ist, solltest du eine Begründung oder Belege verlangen.
3. Keine Einzelverträge über den Vermieter nötig
Du schließt keinen separaten Vertrag mit dem Wasserversorger ab – das macht der Vermieter.
Dein Anteil ergibt sich ausschließlich aus der Betriebskostenabrechnung.
4. Nicht mit Warmwasser verwechseln
Achtung: Warmwasser ist nicht gleich Wasserversorgung!
Die Erwärmung (Heizung, Durchlauferhitzer etc.) zählt zu den Heizkosten, nicht zu den Wasserkosten nach § 2 Nr. 2 BetrKV.
Fazit:
Die Kosten für Frischwasser sind grundsätzlich umlagefähig – aber nur in tatsächlicher Höhe, nachprüfbar, verbrauchsbezogen und ohne Reparaturanteile.
Zählerstände und Preise zu vergleichen kann sich lohnen – und bei Unklarheiten hilft: Belegeinsicht verlangen!
Entwässerung
Wer Wasser bezieht, muss es auch wieder loswerden – und das geschieht über die öffentliche Kanalisation. Die damit verbundenen Kosten tauchen in der Betriebskostenabrechnung unter dem Posten „Entwässerung“ auf.
Was viele Mieter jedoch nicht wissen: Auch hier wird gerne aufgerundet, vermischt oder versteckt abgerechnet – und das nicht selten zulasten der Mietenden.
Was genau zählt zur Entwässerung?
Die Entwässerung umfasst zwei Hauptbestandteile:
- Schmutzwasserentsorgung
= Abwasser aus Bad, Küche, Toilette usw. - Niederschlagswasserentsorgung
= Regenwasser von Dächern, Hofflächen oder anderen versiegelten Flächen
Beide Positionen sind in § 2 Nr. 3 BetrKV als umlagefähig aufgeführt – unter der Bedingung, dass der Mietvertrag die Betriebskostenumlage grundsätzlich vorsieht.
Wer legt die Kosten fest?
Die Kosten entstehen durch kommunale Satzungen und werden in der Regel von den örtlichen Stadtwerken oder Entsorgungsbetrieben erhoben.
- Schmutzwasser wird meist nach dem Frischwasserverbrauch berechnet (also Kubikmeterpreis × Verbrauch).
- Niederschlagswasser hingegen richtet sich oft nach der Größe der versiegelten Fläche des Grundstücks – und zwar in Quadratmetern.
Beispiel:
Du beziehst 40 m³ Wasser pro Jahr, der Abwasserpreis beträgt 2,80 €/m³ → ergibt 112 € Schmutzwassergebühr.
Für 100 m² versiegelte Fläche auf dem Grundstück fallen zusätzlich z. B. 0,90 €/m² → also 90 € an.
Worauf du achten solltest
1. Kombination von Wasserversorgung und Entwässerung
Manche Vermieter fassen beides zusammen unter dem Etikett „Wasserkosten“.
Das ist nicht verboten, aber nicht besonders transparent.
Eine saubere Abrechnung trennt Frischwasser und Entwässerung – und nennt auch die Verbrauchsmengen und Gebühren.
2. Abwasser pauschal abgerechnet?
Wenn keine Verbrauchszähler vorhanden sind, darf der Vermieter den Anteil an den Gesamtkosten anteilig zur Wohnfläche umlegen.
Besser (und fairer) ist aber die Abrechnung nach gemessenem Frischwasserbezug, denn das gibt den besten Näherungswert.
3. Unterschiede bei Dachflächen
Die Regenwassergebühr bezieht sich auf das gesamte Grundstück.
Das bedeutet: Auch Garagendächer, Zufahrten oder Kellerabgänge fließen ein – unabhängig davon, welche Mietparteien sie nutzen.
Der Vermieter darf diese Kosten aber nicht willkürlich verteilen, sondern muss nach Wohnfläche, Parteienzahl oder anderem im Mietvertrag geregelten Schlüssel aufschlüsseln.
4. Keine Wartungsarbeiten enthalten
Rohrreinigung, Hebeanlagenwartung oder Reparaturen an der Entwässerungseinrichtung dürfen nicht unter Entwässerungskosten versteckt werden.
Solche Posten gehören zu Instandhaltung und sind nicht umlagefähig.
Belegpflicht und Nachvollziehbarkeit
Auch bei Entwässerung gilt: Du hast Anspruch auf Einsicht in die zugrunde liegenden Gebührenbescheide oder Sammelrechnungen des Versorgers.
Wenn sich die Zahlen deiner Abrechnung mit den öffentlich einsehbaren Gebührensätzen der Stadt nicht decken, ist das ein Grund zur Nachfrage – oder zum Widerspruch.
Fazit:
Die Entwässerung darf als Betriebskostenposten abgerechnet werden – aber nur in der tatsächlich angefallenen Höhe, nach dem gültigen Gebührensatz und ohne Wartungs- oder Reparaturanteile.
Wer seine Abrechnung hinterfragt, merkt oft schnell: Es gibt mehr Klärungsbedarf als gedacht.
Heizkosten und Warmwasser
Heizkosten und Warmwasser gehören zu den teuersten Betriebskosten überhaupt – und sorgen regelmäßig für Streit. Kein Wunder: Je nach Energieart und Abrechnungsmethode kann sich der Kostenblock schnell auf mehrere Hundert Euro im Jahr summieren. Doch welche Regeln gelten eigentlich? Und was darf der Vermieter tatsächlich abrechnen?
Gesetzliche Grundlage
Die Umlagefähigkeit der Heizkosten und der Warmwasserbereitung ergibt sich aus § 2 Nr. 4 und Nr. 5 der Betriebskostenverordnung (BetrKV).
Allerdings gelten für die genaue Abrechnung zusätzlich die Vorgaben der Heizkostenverordnung (HKVO) – und genau diese schreiben einiges verbindlich vor:
- Abrechnung nach Verbrauch ist Pflicht, sofern das technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist
- Bei zentraler Warmwasserbereitung (z. B. durch die Heizanlage): getrennte Erfassung von Heizenergie und Warmwasser ist vorgeschrieben
- Moderne Messgeräte mit Fernablesung sind verpflichtend, sofern verbaut
Was darf umgelegt werden?
Bei Zentralheizung oder zentraler Warmwasserversorgung durch den Vermieter zählen folgende Kosten zu den umlagefähigen Posten:
- Brennstoffkosten (Gas, Öl, Fernwärme, Pellets etc.)
- Stromkosten der Heizungsanlage
- Wartung und Betrieb der Anlage (nicht jedoch Reparaturen!)
- Kosten für die Abgasmessung und Immissionsschutzmessungen
- Mietkosten für Heizkostenverteiler, Wärmemengenzähler und Warmwasserzähler (nur, wenn im Mietvertrag geregelt)
- Verbrauchserfassung und Abrechnungskosten
Abrechnungsverfahren: Wie wird aufgeteilt?
Nach § 6 HKVO ist die Aufteilung zwingend wie folgt geregelt:
- Mindestens 50 %, höchstens 70 % der Kosten müssen verbrauchsabhängig berechnet werden
- Der restliche Anteil (30–50 %) darf verbrauchsunabhängig nach Wohnfläche oder Personenanzahl verteilt werden
Die konkrete Aufteilung steht entweder im Mietvertrag oder wurde per Aushang oder Mitteilung bekanntgegeben.
Typische Fallstricke und Streitpunkte
1. Abrechnung ohne Verbrauchserfassung?
Nur erlaubt, wenn:
- es technisch nicht möglich ist (z. B. bei sehr kleinen Anlagen) oder
- das Gebäude zu 100 % mit erneuerbaren Energien beheizt wird (Sonderregelung nach § 11 HKVO)
Wenn keiner dieser Fälle zutrifft, ist die verbrauchsabhängige Abrechnung verpflichtend.
2. Alte Verdunster statt moderner Zähler?
Seit Januar 2021 gilt: Bei einem Gerätewechsel müssen fernablesbare Zähler verbaut werden.
Spätestens ab 2027 müssen alle Geräte fernablesbar sein.
Wenn der Vermieter das ignoriert, könnte die Abrechnung angreifbar sein.
3. Wartung vs. Reparatur
Wartung (z. B. Kesselkontrolle, Dichtheitsprüfung) ist umlagefähig.
Austausch von Bauteilen (z. B. defekte Pumpe) oder Komplettreparatur nicht – auch wenn es in der Praxis gerne vermischt wird.
Warmwasser: Anteil richtig berechnet?
Bei zentraler Warmwasserbereitung (also nicht bei Boiler oder Durchlauferhitzer in der Wohnung) muss die Abrechnung nach gemessener oder rechnerischer Abtrennung vom Heizanteil erfolgen.
Wenn kein Wärmemengenzähler für Warmwasser vorhanden ist, darf der Energieanteil nach folgender Formel berechnet werden:
Q = V × (θw – θc) × 2,5 kJ/(kg·K)
Oder kurz gesagt:
Der Energiebedarf hängt vom Wasserverbrauch (V) und der Temperaturdifferenz zwischen Kalt- und Warmwasser ab.
Das ist jedoch nur zulässig, wenn technisch keine Zähler nachrüstbar sind.
Ablesewerte nachvollziehen
Alle Zählerstände (Heizung & Warmwasser) müssen im Rahmen der Abrechnung nachvollziehbar aufgelistet werden.
Bei Fernablesung (z. B. über Funk) muss einmal jährlich eine Verbrauchsinformation erfolgen – z. B. per Brief oder Onlineportal.
Tipp: Eigenes Heizverhalten prüfen
Ein hoher Verbrauch kann auch an schlechter Isolierung, falschem Lüften oder einer defekten Anlage liegen.
Aber eben auch an einer fehlerhaften Abrechnung – deshalb lohnt sich ein Blick auf:
- Vergleichswerte zum Vorjahr
- Den persönlichen Verbrauch in kWh
- Den Preis je kWh (besonders bei Fernwärme kritisch!)
Fazit:
Heizkosten und Warmwasser sind umlagefähig – aber nur, wenn sie verbrauchsabhängig, korrekt aufgeteilt und vollständig belegt sind.
Wenn dir die Zahlen seltsam vorkommen: Belegeinsicht verlangen – und bei Verstößen gegen die HKVO Widerspruch einlegen.
Aufzug
Ein Aufzug im Haus ist bequem – aber auch teuer. Denn Wartung, Prüfung und Betrieb verursachen regelmäßig hohe Kosten, die laut Betriebskostenverordnung grundsätzlich auf die Mieter umgelegt werden dürfen.
Doch Achtung: Nicht jeder Mieter muss automatisch zahlen – und auch nicht alles, was irgendwie mit dem Aufzug zu tun hat, ist umlagefähig.
Gesetzliche Grundlage
Die Betriebskosten für einen Aufzug sind in § 2 Nr. 7 BetrKV geregelt. Dort heißt es:
„Kosten des Betriebs der maschinellen Personen- oder Lastenaufzugsanlagen, insbesondere die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der Beaufsichtigung, Bedienung, Pflege und Überwachung der Anlage sowie der Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Kosten der regelmäßigen Prüfung durch Sachverständige.“
Das heißt: Nur Betriebskosten dürfen abgerechnet werden – nicht die Instandhaltung oder Reparatur!
Was ist umlagefähig?
Umlagefähige Kosten für einen Aufzug sind z. B.:
- Stromkosten für den Betrieb des Aufzugs
- Wartungskosten (regelmäßige Inspektionen, z. B. durch TÜV oder Fachfirma)
- Notrufsysteme und Prüfungen (z. B. Aufschaltung auf 24/7-Zentrale)
- Miete von Fernnotrufsystemen oder Notruftelefonen
- Betriebskosten von Aufzugswärtern, sofern vorhanden
Was ist nicht umlagefähig?
- Reparaturkosten (z. B. Austausch von Motoren, Türen, Steuerungseinheiten)
- Erneuerung oder Modernisierung des Aufzugs
- Umbaukosten (z. B. auf barrierefreien Betrieb)
- Rücklagen für Instandsetzung
- Prüfungen im Rahmen von Reparaturen
Diese Kosten muss der Vermieter selbst tragen – sie dürfen nicht in die Betriebskostenabrechnung einfließen.
Muss ich mitbezahlen, obwohl ich im Erdgeschoss wohne?
Eine der häufigsten Fragen – und juristisch umstritten.
Die kurze Antwort lautet: Ja, aber…
In vielen Fällen werden die Aufzugskosten pauschal nach Wohnfläche oder Personenzahl auf alle Parteien verteilt, unabhängig davon, ob jemand den Aufzug nutzt oder überhaupt erreichen kann.
Das ist laut Rechtsprechung grundsätzlich zulässig, wenn:
- der Mietvertrag eine solche Umlage ausdrücklich vorsieht, und
- der Aufzug objektiv zur Nutzung zur Verfügung steht – auch wenn man ihn nicht nutzt
Aber: Wenn der Aufzug beispielsweise nicht bis in den Erdgeschossbereich führt, sondern erst ab dem 1. Stockwerk, kann eine Kostenumlage auf Erdgeschosswohnungen unzulässig sein.
Gerichtsurteil:
Amtsgericht Köln, Urteil vom 16.05.2013 (Az.: 222 C 20/13):
„Der Mieter muss keine Aufzugskosten zahlen, wenn der Aufzug nicht von seiner Wohnung erreichbar ist.“
Worauf solltest du achten?
- Sind Reparaturkosten (z. B. „Instandsetzung Motor“) aufgeführt? → Nicht zulässig!
- Ist eine Pauschale ohne Aufschlüsselung angesetzt? → Nachfrage stellen!
- Ist der Aufzug überhaupt nutzbar (z. B. bei monatelangem Defekt)? → Umlage zweifelhaft!
- Stehen die Stromkosten des Aufzugs in einem sinnvollen Verhältnis zu dessen Nutzung?
Sonderfall: Aufzugsnotrufsysteme
Seit 2020 sind 24/7-Notrufsysteme mit Fernaufschaltung gesetzlich vorgeschrieben (§ 12 Betriebssicherheitsverordnung).
Deren Kosten (Einbau ausgeschlossen) dürfen als laufende Betriebskosten angesetzt werden, sofern sie vertraglich vereinbart sind.
Fazit:
Die Aufzugskosten gehören zu den umlegbaren Betriebskosten – aber nur dann, wenn sie sich klar auf den Betrieb beziehen und keine Reparaturen enthalten.
Wer im Erdgeschoss wohnt oder den Aufzug nicht nutzen kann, sollte prüfen, ob die Umlage dennoch zulässig ist.
Straßenreinigung
Die Kosten für die Straßenreinigung gehören zu den klassischen Betriebskosten – aber nur dann, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
In vielen Abrechnungen taucht dieser Posten automatisch auf, obwohl in Wirklichkeit gar keine Leistung erbracht wurde oder die Reinigung gar nicht in die Verantwortung des Vermieters fällt.
Gesetzliche Grundlage
Die Umlagefähigkeit der Straßenreinigung ist in § 2 Nr. 8 BetrKV geregelt. Dort steht:
„Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung, soweit sie nicht von der Müllabfuhr erhoben werden.“
Das heißt: Der Vermieter darf diese Kosten nur dann auf die Mieter umlegen, wenn sie ihm auch tatsächlich entstehen – entweder durch eine kommunale Gebühr oder durch eine beauftragte Fremdfirma.
Was ist umlagefähig?
- Kommunale Gebühren für die Straßenreinigung, sofern sie dem Eigentümer (also dem Vermieter) in Rechnung gestellt werden
- Kosten für beauftragte Reinigungsfirmen, die regelmäßig Gehwege oder Zufahrten reinigen
- Materialkosten im Rahmen der Dienstleistung (z. B. Streugutbehälter bei kombinierten Verträgen mit Winterdienst)
Voraussetzung: Die zu reinigende Fläche gehört zum Grundstück oder ist vom Eigentümer laut Satzung der Stadt zu reinigen
Was ist nicht umlagefähig?
- Reinigung öffentlicher Straßen, wenn diese ausschließlich durch die Stadt erfolgt und keine Kosten auf den Eigentümer umgelegt werden
- Einmalige Reinigungen (z. B. nach Bauarbeiten oder bei Mieterwechsel)
- Selbst durchgeführte Arbeiten durch den Vermieter oder Dritte, ohne konkrete Abrechnung oder Beauftragung
Wer ist überhaupt zuständig?
Ob die Reinigungspflicht beim Eigentümer oder bei der Stadt liegt, regelt die örtliche Straßenreinigungssatzung. Diese legt fest:
- Welche Straßenabschnitte gereinigt werden müssen
- Ob die Stadt selbst oder der Anlieger (also der Eigentümer/Vermieter) zuständig ist
- In welchen Intervallen gereinigt wird
Beispiel:
Wenn die Stadt den Gehweg regelmäßig mit der Kehrmaschine reinigt, ist das Sache der Kommune – und darf nicht über die Betriebskosten abgerechnet werden.
Typische Streitfälle
1. Keine erkennbare Leistung
Wenn nie jemand kehrt, aber trotzdem jährlich dreistellige Beträge abgerechnet werden, liegt der Verdacht nahe: Hier wird etwas angesetzt, was nicht existiert.
Ein solcher Posten ist nicht umlagefähig, solange der Vermieter keine Belege und Verträge vorlegen kann.
2. Doppelte Abrechnung
Einige Vermieter lassen sowohl Straßenreinigung und Winterdienst pauschal durch dieselbe Firma erledigen – und schlagen dann beide Posten separat in voller Höhe auf.
Wenn aber eine Kombirechnung vorliegt, muss diese aufgeschlüsselt werden.
3. Mieter reinigen selbst
Wenn die Mieter laut Hausordnung zur Gehwegreinigung verpflichtet sind (z. B. reihum), darf der Vermieter keine zusätzlichen Kosten dafür berechnen.
Was kannst du prüfen?
- Wer kehrt eigentlich wirklich? Stadt? Dienstleister? Mieter selbst?
- Gibt es eine kommunale Gebührensatzung? Falls ja: Taucht der Vermieter dort als Zahler auf?
- Wurde eine Firma beauftragt? Dann muss es Rechnungen geben – Einsicht verlangen!
- Wurde doppelt abgerechnet? Straßenreinigung und Winterdienst dürfen sich nicht überlagern
Fazit:
Die Kosten der Straßenreinigung sind nur dann umlagefähig, wenn sie dem Vermieter tatsächlich entstehen – und auch nur für Flächen, die nicht öffentlich durch die Stadt gereinigt werden.
Wenn du seit Jahren keinen Straßenkehrer gesehen hast, solltest du die Abrechnung kritisch hinterfragen – und gegebenenfalls Belege einfordern.
Müllabfuhr
Die Müllabfuhr gehört zu den unumstrittenen umlagefähigen Betriebskosten – zumindest was die normalen, regelmäßig geleerten Mülltonnen angeht.
Doch oft verstecken sich unter diesem Posten zusätzliche Kosten, die dort eigentlich nichts zu suchen haben – allen voran der Sperrmüll.
Gesetzliche Grundlage
Laut § 2 Nr. 8 BetrKV zählen zu den umlagefähigen Betriebskosten:
„Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung, soweit sie nicht von der Müllabfuhr erhoben werden.“
Was auf den ersten Blick nach Pauschal-Erlaubnis klingt, ist in Wahrheit recht eng gefasst.
Was ist umlagefähig?
Folgende Kosten dürfen in der Regel auf die Mieter umgelegt werden:
- Regelmäßige Müllentsorgung durch die kommunale Abfallwirtschaft (Restmüll, Papier, Bio, ggf. Gelber Sack/Tonne)
- Grundgebühren und Behältermieten, sofern nicht bereits in der Abfallgebühr enthalten
- Kosten für zusätzliche Leerungen, wenn die Tonnen regelmäßig überfüllt sind (sofern nachweisbar notwendig)
Voraussetzung: Die Gebühren werden dem Vermieter in Rechnung gestellt und sind konkret belegbar.
Was ist nicht umlagefähig?
- Sperrmüllkosten, sofern sie nicht durch alle Mieter gemeinsam verursacht wurden
- Sonderabfuhren aufgrund illegaler Entsorgung durch Dritte oder einzelne Bewohner
- Bußgelder oder Verwarnungen wegen unsachgemäßer Entsorgung
- Müllentsorgung nach Renovierungen, Wohnungsräumungen oder Mieterwechseln
- Kosten für Mülltrennung oder -schulungen (z. B. durch Dritte beauftragt)
Merke: Alles, was nicht zur regelmäßigen, haushaltsüblichen Entsorgung gehört, ist keine Betriebskostenposition.
Sonderfall: Sperrmüll
Sperrmüll ist einer der häufigsten Streitpunkte in Betriebskostenabrechnungen – und das aus gutem Grund. Denn:
- Er fällt unregelmäßig an
- Er wird häufig durch einzelne Mieter oder sogar Dritte verursacht
- Die Kosten sind oft hoch – und werden dann einfach auf alle verteilt
Rechtsprechung dazu:
- LG Berlin, Urteil vom 21.01.2004 (Az. 64 S 390/03):
Sperrmüll darf nur dann auf alle Mieter umgelegt werden, wenn er regelmäßig und allgemein anfällt – nicht bei individueller Verursachung. - AG Köln, Urteil vom 16.02.2006 (Az. 205 C 270/05):
Kosten für Sperrmüll nach Wohnungsräumung dürfen nicht auf andere Mieter abgewälzt werden.
Der Vermieter muss nachweisen, dass der Sperrmüll regelmäßig und durch die gemeinschaftliche Nutzung anfällt (z. B. durch die gemeinsame Nutzung eines Sperrmüllplatzes o. Ä.).
Einmalaktionen oder Müllberge nach Auszug einzelner Mieter dürfen nicht einfach auf die Gesamtheit umgelegt werden.
Was du prüfen solltest:
- Stehen Sperrmüllkosten separat in der Abrechnung? → Genau hinschauen!
- Wird der konkrete Anlass genannt? (z. B. „Räumung Whg. 4 links“) → Nicht umlagefähig!
- Sind Foto- oder Abholnachweise vorhanden? → Recht auf Einsicht!
- Gibt es Regelungen im Mietvertrag oder in der Hausordnung zur Sperrmüllentsorgung?
Beispiel aus der Praxis:
Ein Mieter zieht in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus und hinterlässt die Wohnung voll mit Möbeln und Müll.
Die Verwaltung lässt alles abholen – und verteilt die gesamten Kosten auf die verbliebenen Mieter unter „Müllabfuhr/Sperrmüll“.
Das ist unzulässig. Die Kosten hätte der Vermieter tragen müssen – oder gegen den Verursacher vorgehen.
Tipp:
Wenn du vermutest, dass unzulässiger Sperrmüll abgerechnet wurde:
- Widerspruch einlegen und Belegeinsicht verlangen
- Auf die oben genannten Urteile hinweisen
- Zahlung ggf. unter Vorbehalt leisten
Fazit:
Die Müllabfuhr ist an sich umlagefähig – aber der Sperrmüll nicht pauschal.
Hier lohnt sich ein genauer Blick, denn nicht selten werden fragwürdige Zusatzkosten unter einem vermeintlich legitimen Posten versteckt.
Gebäudereinigung / Hausreinigung
Wenn es um die Hausreinigung geht, ist Streit fast schon vorprogrammiert.
Früher war es üblich, dass die Mieter im Wechsel das Treppenhaus selbst putzen. Heute dagegen setzen viele Vermieter auf beauftragte Reinigungskräfte – nicht immer zur Freude der Bewohner.
Und nicht selten stellt sich die Frage: Wer putzt hier eigentlich – und was genau kostet das?
Gesetzliche Grundlage
Die Kosten für die Gebäudereinigung sind laut § 2 Nr. 9 BetrKV umlagefähig. Dort heißt es:
„Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung.“
Der Gesetzgeber erlaubt also, dass die regelmäßige Reinigung von gemeinsam genutzten Bereichen wie Treppenhaus, Keller, Flur oder Zugangswegen über die Betriebskosten auf die Mieter umgelegt wird.
Was ist umlagefähig?
- Reinigung von:
- Treppenhäusern
- Hausfluren
- Kellergängen
- Waschräumen / Trockenräumen
- Eingangsbereichen und Zuwegungen (falls Teil des Gebäudes)
- Kosten für Reinigungsmittel und Geräte (sofern gesondert berechnet)
- Lohnkosten für Reinigungskräfte, auch wenn diese direkt vom Vermieter angestellt sind
- Reinigung durch externe Dienstleister
Was ist nicht umlagefähig?
- Sonderreinigungen nach Vandalismus, Wasserschaden oder Sanierung
- Grundreinigungen oder Bauendreinigungen bei Renovierung oder Umbau
- Verwaltungskosten (z. B. für Organisation der Reinigung, Kontrolle oder Kommunikation mit Dienstleistern)
- Reinigung von nicht allgemein zugänglichen Bereichen
Typische Streitpunkte
1. Reinigungsdienst ohne erkennbare Leistung
In manchen Fällen wird ein Reinigungsdienst beauftragt, aber kaum oder unregelmäßig vor Ort gesichtet.
Wenn beispielsweise nur ein- oder zweimal im Monat geputzt wird, aber dennoch jährlich mehrere hundert Euro in der Abrechnung auftauchen, lohnt sich ein genauerer Blick.
Belegeinsicht verlangen! Der Vermieter muss offenlegen:
- Wer reinigt
- Wie oft
- Was genau gereinigt wird
- Was es kostet
2. Reinigung durch eigenes Personal
Manche Vermieter beauftragen kein externes Reinigungsunternehmen, sondern lassen die Hausreinigung von eigenen Mitarbeitern erledigen – etwa durch den Hauswart oder andere interne Kräfte.
Das ist grundsätzlich zulässig und kann auf die Mieter umgelegt werden, allerdings nur in Höhe der tatsächlichen Lohnkosten für die reinen Reinigungsarbeiten.
Auch hier gilt: Die Mieter haben ein Recht auf Einsicht in entsprechende Nachweise – etwa über Zeitaufwand, Lohnanteile oder den Umfang der Tätigkeiten. Verwaltungstätigkeiten oder nicht umlegbare Arbeiten dürfen dabei nicht in die Betriebskosten einfließen.
3. Doppelte Abrechnung
Wichtig ist auch, dass keine Leistungen doppelt berechnet werden.
Wird z. B. eine Hausreinigung über den Hauswart-Posten bereits abgedeckt, darf sie nicht zusätzlich als eigener Kostenpunkt auftauchen – es sei denn, beide Leistungen sind klar getrennt und begründet.
4. Reinigungsplan ohne Mieterpflicht, aber trotzdem Abrechnung
In älteren Mietverträgen oder Hausordnungen finden sich manchmal noch Pläne zur Reinigung im Mieterwechsel.
Wenn diese Praxis offiziell beendet wurde und ein professioneller Reinigungsdienst die Arbeit übernimmt, darf das erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung abgerechnet werden – nicht rückwirkend.
Gerichtsurteile zur Hausreinigung
- LG Berlin, Urteil vom 20.01.2009 (Az. 63 S 398/08):
Auch bei Reinigung durch eigenes Personal müssen konkrete Lohn- und Zeiterfassungen vorliegen. - AG Gelsenkirchen, Urteil vom 03.07.2007 (Az. 202 C 63/07):
Eine Reinigung alle 2 Wochen rechtfertigt keine hohen Jahreskosten ohne nachvollziehbare Nachweise.
Was sollte in der Abrechnung stehen?
Eine saubere (im doppelten Sinne) Betriebskostenabrechnung sollte z. B. so aussehen:
| Leistung | Anbieter | Turnus | Jahreskosten | Mieteranteil |
|---|---|---|---|---|
| Hausreinigung | Reinigungsdienst XY | wöchentlich | 3.000 € | 120,00 € |
Fehlen solche Angaben oder werden Pauschalbeträge genannt („Hausreinigung 150 €“), darf und sollte man nachhaken.
Fazit:
Die Gebäudereinigung ist umlagefähig – aber nicht um jeden Preis und nicht ohne klare Nachweise.
Wenn du nie einen Putzdienst siehst, aber regelmäßig dafür zahlst, solltest du auf dein Recht zur Belegeinsicht bestehen.
Und auch der Verweis auf angebliche „Sicherheitsvorgaben“ reicht nicht als Freifahrtschein für beliebige Kostenansätze.
Gartenpflege & Baumpflege
Grüne Außenanlagen werten jedes Wohnhaus auf – zumindest dann, wenn sie ordentlich gepflegt werden. Doch genau hier liegt oft das Problem: Die Qualität der Gartenpflege steht nicht immer im Verhältnis zu den abgerechneten Kosten.
Viele Mieter fragen sich: Was darf überhaupt auf die Betriebskosten umgelegt werden? Und was nicht?
Gesetzliche Grundlage
Laut § 2 Nr. 10 BetrKV gehören zu den umlagefähigen Betriebskosten:
„Die Kosten der Gartenpflege, einschließlich der Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen sowie der Pflege von Spielplätzen.“
Baumpflege ist nicht explizit erwähnt, wird aber von der Rechtsprechung in Teilen der Gartenpflege zugerechnet – sofern es sich nicht um Ersatzpflanzungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen oder Baumfällungen handelt. Diese zählen meist als Instandhaltung und dürfen nicht umgelegt werden.
Was ist umlagefähig?
- Rasenmähen und Pflege von Grünflächen
- Heckenschnitt, Rückschnitt von Sträuchern und Ziergehölzen
- Laubentfernung im Herbst
- Pflege von Beeten und Rabatten
- Reinigung von Gartenwegen (wenn nicht unter „Straßenreinigung“ abgerechnet)
- Wartung von Spielplätzen, inkl. Sandaustausch und Kontrolle der Geräte
- leichte Baumpflege, z. B. Formschnitt oder Entfernen toter Äste
Was ist nicht umlagefähig?
- Fällung von Bäumen
- Entfernung von Wurzeln oder Baumstümpfen
- Neupflanzung von Bäumen oder Büschen
- Ersatz kaputter Gartenmöbel oder Spielgeräte
- Gartenneugestaltung oder Umbaumaßnahmen
- Pflege von Flächen, die nicht öffentlich oder gemeinschaftlich zugänglich sind
Typische Streitpunkte
1. Kaum gepflegt, aber teuer abgerechnet
Ein häufiger Kritikpunkt: Die Gartenpflege findet selten oder nur oberflächlich statt – doch die Jahreskosten sind auffallend hoch.
Besonders bei Rasenflächen ist oft zu beobachten, dass nur alle paar Wochen gemäht wird, unabhängig vom Zustand des Bodens oder Wetters.
Auch Hecken werden manchmal über Jahre nicht geschnitten, obwohl jährlich entsprechende Kosten abgerechnet werden.
Tipp: Mieter können bei auffälligen Kosten eine detaillierte Aufschlüsselung verlangen – mit Angabe, wann und wie oft Gartenarbeiten durchgeführt wurden.
2. Baumpflege als Kostenfalle
Sobald es um Bäume geht, wird es oft teuer. Professionelle Baumpfleger, die mit Seilklettertechnik oder Hubsteiger arbeiten, kosten mehrere hundert Euro – pro Einsatz.
Umlagefähig sind nur einfache Pflegemaßnahmen wie Formschnitt oder Entfernen loser Äste.
Nicht umlegbar sind Verkehrssicherungsmaßnahmen, das Fällen von Bäumen oder deren Ersatz – diese gelten als Instandhaltungs- oder Verwaltungskosten.
Beispiel-Urteil:
AG Köpenick, Urteil vom 15.02.2012 (Az. 4 C 292/11):
Kosten für eine Baumfällung durften nicht auf die Mieter umgelegt werden.
3. Pauschale Kosten ohne Nachweis
Manche Abrechnungen enthalten pauschale Positionen wie „Gartenpflege 1.000 €“ ohne weitere Erläuterung.
Auch hier gilt: Belegeinsicht ist dein Recht.
Verlange Einsicht in:
- Wartungsberichte
- Einsatzpläne
- Rechnungen von Dienstleistern
So lässt sich prüfen, ob die Leistungen überhaupt stattgefunden haben – und ob sie im richtigen Verhältnis zum Preis stehen.
Was gehört in die Abrechnung?
Transparente Abrechnungen sollten zumindest folgende Infos enthalten:
| Leistung | Anbieter | Häufigkeit | Jahreskosten | Mieteranteil |
|---|---|---|---|---|
| Gartenpflege | Firma XY | 14-täglich Mai–Okt | 2.400 € | 100,00 € |
| Baumpflege | Baumdienst ABC | 1x jährlich | 600 € | 25,00 € |
Fazit:
Gartenpflege ist umlagefähig – aber nicht jede Sägeaktion in den Bäumen.
Wenn nur unregelmäßig gemäht wird oder Hecken vernachlässigt aussehen, ist eine hohe Abrechnung nicht gerechtfertigt.
Mieter sollten sich nicht scheuen, Nachweise einzufordern – und im Zweifel prüfen lassen, ob wirklich alle abgerechneten Maßnahmen zulässig sind.
Beleuchtung
Ein funktionierendes Beleuchtungssystem gehört zur grundlegenden Infrastruktur eines Mietshauses – sei es im Treppenhaus, im Keller, an der Hausfassade oder auf den Zuwegungen zum Gebäude. Doch wie sieht es mit den Kosten dafür aus?
Welche Stromkosten für die Beleuchtung darf der Vermieter auf die Mieter umlegen – und worauf sollten Mieter besonders achten?
Gesetzliche Grundlage
Die Betriebskostenverordnung (§ 2 Nr. 11 BetrKV) erlaubt die Umlage folgender Kosten:
„Die Kosten der Beleuchtung, insbesondere der Beleuchtung von gemeinschaftlich genutzten Gebäudeteilen, Zugängen und Außenanlagen.“
Das umfasst z. B.:
- Treppenhausbeleuchtung
- Kellerflure und Dachböden
- Hausflure, Eingangsbereiche
- Außenbeleuchtung (z. B. mit Bewegungsmelder)
- Beleuchtung von Müllplätzen oder Fahrradabstellbereichen
Nicht umlegbar sind Stromkosten für private Kellerräume oder Garagen, wenn diese über eigene Zähler laufen.
Was ist umlagefähig?
- Stromverbrauch für alle gemeinschaftlich genutzten Leuchtmittel (Flure, Hauszugänge usw.)
- Wartungskosten, z. B. für den Austausch defekter Leuchtmittel (sofern nicht über Instandhaltung abgedeckt)
- Stromzähler-Grundgebühr, wenn ein separater Zähler für die Hausbeleuchtung existiert
Was ist nicht umlagefähig?
- Stromkosten für private Nutzflächen (z. B. Einzelkeller mit eigenem Licht)
- Neuanlage oder Modernisierung des Beleuchtungssystems
- Reparaturen am elektrischen Netz (Kabel, Schalter etc.)
- Stromverbrauch für Baustellenleuchten oder Werbebeleuchtung
Häufige Probleme
1. Unverhältnismäßig hohe Stromkosten
Wenn in der Abrechnung plötzlich dreistellige Beträge pro Jahr und Mieter für „Beleuchtung“ auftauchen, sollte man misstrauisch werden – insbesondere dann, wenn:
- Es nur wenige Leuchten im Treppenhaus gibt
- Bewegungsmelder die Betriebszeit begrenzen
- LED-Leuchtmittel verwendet werden (niedriger Verbrauch)
- Keine Dauerbeleuchtung vorhanden ist
Tipp: Nachfragen, wie viele Kilowattstunden tatsächlich verbraucht wurden – oder ob pauschale Werte angesetzt wurden, was unzulässig ist.
2. Außenbeleuchtung als Kostenfalle
Außenleuchten sind in der Regel zeitgesteuert (z. B. Dämmerungsschalter) oder per Bewegungsmelder geschaltet.
Wenn sie nur abends aktiv sind, ist der Stromverbrauch gering – aber manchmal scheint die Abrechnung etwas anderes zu behaupten.
Hier lohnt sich ein Blick auf die Abrechnungsperiode und den tatsächlichen Betrieb der Leuchten.
3. Intransparente Sammelposten
Einzelne Abrechnungen enthalten Posten wie „Strom Allgemein“ oder „Beleuchtung / Technik“, ohne konkrete Aufschlüsselung.
Nachfragen lohnt sich:
Welche Leuchtmittel wurden einbezogen? Wie wurde der Verbrauch erfasst? Existieren separate Zähler?
Beispielrechnung (vereinfacht)
| Position | Menge/Einheit | Verbrauch | Kosten |
|---|---|---|---|
| Treppenhaus (LED-Leuchten) | 5 Leuchten à 6 W | 300 kWh | 120 € |
| Außenleuchte (Bewegungsmelder) | 1 Leuchte | 50 kWh | 20 € |
| Stromzähler-Grundgebühr | 1x jährlich | — | 15 € |
| Gesamtkosten | 155 € | ||
| Anteil pro Mieter (5 Mieter) | 31,00 € |
Fazit:
Die Stromkosten für die Beleuchtung sind grundsätzlich umlagefähig, dürfen aber nicht geschätzt oder pauschal angesetzt werden.
Besonders bei geringer Nutzung (z. B. LED + Bewegungsmelder) sind hohe Jahresbeträge nicht nachvollziehbar.
Mieter haben das Recht auf klare Aufschlüsselung und Einsicht in Verbrauchsdaten oder Rechnungen.
Schornsteinfeger
Auch wenn viele Mieter im Alltag kaum noch Kontakt mit dem Schornsteinfeger haben, taucht dessen Tätigkeit nach wie vor regelmäßig auf der Betriebskostenabrechnung auf – meist unter der Bezeichnung „Schornsteinfeger“, „Schornsteinreinigung“ oder „Feuerstättenschau“.
Was davon ist umlagefähig? Und was steckt eigentlich hinter diesen Kosten?
Gesetzliche Grundlage
Die Betriebskostenverordnung erlaubt unter § 2 Nr. 12 BetrKV ausdrücklich die Umlage folgender Kosten:
„Die Kosten der regelmäßigen Überprüfung und Reinigung von Heizungsanlagen, Abgasleitungen und Schornsteinen durch den Schornsteinfeger.“
Es geht also konkret um Tätigkeiten, die regelmäßig durchgeführt werden müssen und der Betriebssicherheit dienen – nicht um Reparaturen oder bauliche Maßnahmen.
Welche Leistungen sind umlagefähig?
Zu den umlagefähigen Schornsteinfegerkosten zählen in der Regel:
- Regelmäßige Kehrungen und Reinigungen von Schornsteinen und Abgaszügen
- Abgaswegemessungen bei Heizungsanlagen
- Feuerstättenschau (Sicherheitsüberprüfung durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger)
- Ausstellung des Feuerstättenbescheids
- Dokumentation gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
Diese Leistungen sind gesetzlich vorgeschrieben – der Vermieter muss sie veranlassen, und die entsprechenden Kosten dürfen auf die Mieter umgelegt werden, sofern eine entsprechende Regelung im Mietvertrag besteht.
Nicht umlagefähig sind z. B.:
- Reparaturen oder Austausch von Schornsteinen oder Heizungsbestandteilen
- Kosten für eine Energieberatung oder freiwillige zusätzliche Messungen
- Erstprüfungen nach Neubau oder Sanierung
- Verwaltungsgebühren oder Aufwendungen des Vermieters
Gilt das auch bei Zentralheizung oder Fernwärme?
Ja – auch bei zentralen Heizungsanlagen in Mehrfamilienhäusern sind regelmäßig Abgasprüfungen und technische Kontrollen durch den Schornsteinfeger erforderlich.
Nur wenn weder eine eigene Heizungsanlage noch Abgasleitungen vorhanden sind (z. B. bei Fernwärme mit vollständiger Außenversorgung), entfallen diese Kosten.
Transparenz und Kontrolle
- Die Kosten des Schornsteinfegers müssen nachvollziehbar aufgeschlüsselt sein
- Es sollte erkennbar sein, welche Tätigkeiten durchgeführt wurden und welcher Zeitraum betroffen ist
- Eine pauschale Angabe wie „Schornsteinfeger: 230 €“ ohne weiteren Hinweis genügt nicht
Tipp: Bei Unklarheiten kann man sich eine Kopie der Schornsteinfegerrechnung zeigen lassen – sie enthält in der Regel alle Einzelleistungen mit Preisaufschlüsselung.
Beispielrechnung (vereinfacht)
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| Abgaswegemessung Heizung | 58,00 € |
| Schornsteinreinigung (2x/Jahr) | 44,00 € |
| Feuerstättenschau | 32,00 € |
| Gesamtkosten | 134,00 € |
| Anteil pro Mieter (4 Mieter) | 33,50 € |
Fazit
Die Kosten für den Schornsteinfeger sind in vielen Fällen umlagefähig, sofern sie sich auf Pflichtaufgaben nach Kehr- und Überprüfungsverordnung beziehen.
Bei ungewöhnlich hohen Beträgen, fehlender Heizungsanlage oder pauschalen Angaben ist jedoch Vorsicht geboten – und ein Blick in die Einzelrechnung ratsam.
Versicherungen (Gebäude, Haftpflicht etc.)
Versicherungen sind ein wichtiger Bestandteil des Gebäudebetriebs und schützen sowohl Eigentümer als auch Mieter vor finanziellen Schäden.
Doch längst nicht jede Versicherung, die ein Vermieter abschließt, darf auch über die Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umgelegt werden.
Hier erfährst du, welche Versicherungsarten umlagefähig sind, welche nicht, und worauf du bei der Abrechnung achten solltest.
Gesetzliche Grundlage
Nach § 2 Nr. 13 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) sind folgende Versicherungen umlagefähig:
„Die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung, insbesondere die Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, Wasser- sowie sonstige Elementarschäden, die Glasversicherung und die Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und Aufzug.“
Das bedeutet: Nur gebäudebezogene Versicherungen dürfen abgerechnet werden – keine allgemeinen oder verwalterbezogenen Policen.
Umlagefähige Versicherungen
- Gebäudeversicherung
– Schutz gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Blitzschlag, Elementarschäden
– Auch Glasbruch ist mitversicherbar (z. B. Fenster, Eingangstür) - Haftpflichtversicherung für das Gebäude
– Versichert z. B. Sturzunfälle durch lose Gehwegplatten, herabfallende Dachziegel, glatte Wege
– Auch Schäden durch Öltank oder Aufzug (sofern vorhanden) sind abgedeckt - Aufzugsversicherung (falls separat abgeschlossen)
– Nur bei vorhandenem Aufzug und nur, wenn keine Doppelversicherung vorliegt - Sachversicherung für Gemeinschaftseinrichtungen
– Z. B. Fahrradabstellräume, Waschkeller oder Antennenanlagen (sofern explizit gebäudebezogen)
Nicht umlagefähige Versicherungen
- Haus- oder Wohnungshaftpflicht des Vermieters (privat oder gewerblich)
- Rechtsschutzversicherungen, z. B. für Eigentümerstreitigkeiten
- Mietausfallversicherungen
- Verwaltungshaftpflicht, Bauleistungs- oder Bauwesenversicherungen
- Inhaltsversicherungen, die bewegliches Eigentum des Vermieters absichern
- Sonstige Pauschalpolicen, wenn der Bezug zum Gebäude nicht eindeutig ist
Was du bei der Abrechnung prüfen solltest
- Sind alle Kostenarten getrennt ausgewiesen (Gebäude, Haftpflicht, Glas usw.)?
- Ist der Gesamtbetrag nicht auffällig hoch? Eine Gebäudeversicherung kostet je nach Lage und Größe oft zwischen 200–500 € pro Jahr.
- Enthält die Abrechnung keine nicht umlagefähigen Versicherungen?
- Gibt es Doppelversicherungen (z. B. Haftpflicht doppelt über Hausverwaltung und Eigentümer)?
Tipp: Fordere bei Zweifeln die Versicherungspolice oder Beitragsrechnung an – du hast das Recht zur Belegeinsicht.
Beispielrechnung (jährlich, Mehrfamilienhaus)
| Versicherungstyp | Betrag |
|---|---|
| Gebäudeversicherung | 270,00 € |
| Gebäudehaftpflicht | 80,00 € |
| Glasversicherung (Gemeinschaft) | 40,00 € |
| Gesamtkosten | 390,00 € |
| Anteil pro Mieter (6 Parteien) | 65,00 € |
Häufige Tricks und Fehler
- Versicherungsposten ohne genaue Bezeichnung („Versicherung allgemein“)
→ immer nachhaken, worum es sich konkret handelt - Vermischung zulässiger und unzulässiger Positionen
→ z. B. Rechtsschutz- oder Mietausfallversicherung stillschweigend enthalten - Veraltete oder überhöhte Policen
→ besonders bei Altverträgen: Prämien regelmäßig vergleichen lassen
Fazit
Nur gebäudebezogene Sach- und Haftpflichtversicherungen sind als Betriebskosten auf Mieter umlegbar – alles andere ist Sache des Eigentümers.
Eine detaillierte Aufschlüsselung der Versicherungsposten ist Pflicht. Pauschale oder nicht nachvollziehbare Angaben sollten kritisch hinterfragt werden.
Hauswart / Hausmeister
Der Hauswart oder Hausmeister ist in vielen Wohnanlagen eine bekannte Figur – mal als direkte Bezugsperson, mal als Dienstleister im Hintergrund.
Doch nicht jede „Hauswart“-Position rechtfertigt automatisch einen Kostenpunkt in der Betriebskostenabrechnung.
Was darf der Vermieter wirklich abrechnen? Und welche Leistungen gehören nicht dazu?
Gesetzliche Grundlage
Nach § 2 Nr. 14 BetrKV dürfen die Kosten des Hauswarts umgelegt werden – allerdings nur, soweit es sich um Betriebskosten im engeren Sinne handelt.
Wörtlich heißt es:
„Die Kosten des Hauswarts, soweit sie nicht bereits unter Nummern 1 bis 13 fallen. Nicht umlagefähig sind die Kosten für die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung und Verwaltung.“
Das bedeutet:
👉 Nur laufende, gebäudebezogene Dienstleistungen des Hausmeisters dürfen auf die Mieter verteilt werden.
Umlagefähige Tätigkeiten
Zu den umlagefähigen Leistungen zählen insbesondere:
- Treppenhaus- und Flurreinigung (wenn nicht separat abgerechnet)
- Kontrolle der technischen Anlagen (z. B. Heizungsraum, Aufzug)
- Schließdienste und Kontrolle von Zugängen
- Kleinere Wartungsarbeiten (z. B. Sicherungen tauschen)
- Pflege von Außenanlagen, wenn vom Hauswart übernommen
- Koordination von Dienstleistern vor Ort
Wichtig: Solche Tätigkeiten müssen nachweislich erbracht worden sein, sonst dürfen sie nicht berechnet werden!
Nicht umlagefähig sind z. B.:
- Verwaltungsaufgaben (z. B. Mieterakten, Nebenkostenabrechnung)
- Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen
- Kontrollfahrten ohne erkennbare Leistung
- Bereitschaft ohne tatsächlichen Einsatz
- Zeitaufwand für Schriftverkehr oder Mahnungen
- Tätigkeiten, die bereits in anderen Betriebskostenpositionen enthalten sind (z. B. Gartenpflege, Müllmanagement)
Was bei der Abrechnung wichtig ist
- Klarer Nachweis, welche Aufgaben der Hauswart konkret übernommen hat
- Keine Doppelabrechnungen – z. B. „Hausreinigung“ und „Hauswart“ für dieselbe Leistung
- Bei externer Beauftragung: Abgrenzung von Verwaltungskosten
- Kein Hauswart vor Ort? → Dann auch keine pauschale Abrechnung zulässig!
Tipp: Bei Zweifeln kannst du eine Tätigkeitsübersicht oder Stundenabrechnung verlangen – das ist dein gutes Recht!
Beispielrechnung (vereinfacht)
| Leistung | Anteil jährl. |
|---|---|
| Reinigung Treppenhaus | 180,00 € |
| Kontrolle Heizungskeller | 60,00 € |
| Kleinreparaturen | 20,00 € |
| Gesamtkosten je Wohnung | 260,00 € |
Liegt die Abrechnung pauschal bei über 300 € im Jahr, sollte genau geprüft werden, ob alle Tätigkeiten gerechtfertigt sind.
Typische Fallstricke
- Kein Hausmeister tätig, aber trotzdem Kosten abgerechnet
- Externer Dienstleister, der nur sporadisch erscheint
- Verrechnung über Hausverwaltung, ohne reale Gegenleistung
- Hauswart ist gleichzeitig Verwalter – → Verwaltungskosten sind nicht umlagefähig!
Gerichtsurteile und Hinweise
- BGH, Urteil vom 20.02.2008 (VIII ZR 27/07):
→ „Nur die tatsächlich erbrachten, regelmäßig wiederkehrenden Leistungen des Hauswarts sind umlagefähig.“ - AG Berlin-Mitte, Urteil vom 21.12.2007 (5 C 93/07):
→ „Eine pauschale Hauswartposition ohne Leistungsnachweis ist unzulässig.“
Fazit
Die Hauswartkosten gehören zu den klassischen Betriebskosten – aber nur, wenn auch tatsächlich Leistungen erbracht wurden, die nicht schon in anderen Positionen enthalten sind.
Mieter sollten genau hinschauen, ob überhaupt ein Hausmeister tätig war, und sich nicht mit pauschalen Angaben abspeisen lassen.
Gemeinschaftsantennenanlagen / Kabelanschluss
Der Kabelanschluss war über Jahrzehnte hinweg ein fester Bestandteil vieler Betriebskostenabrechnungen – oft als „Kabelgebühren“, „TV-Anschluss“ oder „Gemeinschaftsantennenanlage“ bezeichnet.
Doch durch die Reform des Telekommunikationsgesetzes (TKG) ist damit nun endgültig Schluss – zumindest was die Umlage über die Betriebskosten angeht.
Gesetzliche Grundlage laut BetrKV
In § 2 Nr. 15 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) ist geregelt:
„Die Kosten des Betriebs der Gemeinschaftsantennenanlage oder der mit einem Breitbandnetz verbundenen privaten Verteilanlage.“
Solche Kosten waren also grundsätzlich umlagefähig – allerdings nur, wenn die Antennenanlage oder das Kabelnetz gemeinschaftlich betrieben wurde und dies im Mietvertrag vereinbart war.
Was passierte am 1. Dezember 2021?
An diesem Tag trat das neue Telekommunikationsgesetz (TKG) in Kraft – und damit auch § 72 TKG, der besagt:
„Der Anspruch des Vermieters gegen den Mieter auf Erstattung der laufenden Betriebskosten […] erlischt mit Ablauf des 30. Juni 2024.“
Heißt konkret:
- Bis zum 30. Juni 2024 durften Kabelgebühren bei Sammelverträgen noch über die Betriebskosten abgerechnet werden – sofern sie im Mietvertrag geregelt waren.
- Ab dem 1. Juli 2024 ist diese Umlage nicht mehr erlaubt – unabhängig davon, ob ein Sammelvertrag besteht oder nicht.
- Mieter müssen seither selbst entscheiden, ob sie einen TV-Anschluss wollen – und mit welchem Anbieter.
Was ist (noch) zulässig?
- Kosten für den Betrieb einer Gemeinschaftsantennenanlage (z. B. Wartung, Strom für Verstärker) – wenn tatsächlich vorhanden
- Kabelanschlusskosten für das erste Halbjahr 2024 – anteilig, z. B. 6 von 12 Monaten, also 50 %
- Nur dann, wenn dies im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart wurde
Was ist nicht mehr zulässig?
- Eine pauschale Abrechnung der Kabelgebühren über die gesamten 12 Monate des Jahres 2024
- Die Umlage von Einzelverträgen, die Mieter eigenständig abgeschlossen haben
- Versteckte Weiterberechnung unter anderen Posten wie „Technikpauschale“ oder „Hausbetriebskosten“
Beispiel
Ein Gebäude mit 10 Mietparteien hat einen Sammelvertrag über 540 € pro Jahr. Für die Abrechnung 2024 dürften davon nur 270 € (50 %) umgelegt werden – also 27 € pro Wohnung, wenn der Mietvertrag dies erlaubt. Ab Juli 2024 darf keine weitere Umlage erfolgen.
Fazit
Seit Juli 2024 ist der pauschale Kabelanschluss über die Nebenkosten Geschichte.
Mieter zahlen nur noch dann für TV oder Internet, wenn sie selbst einen Vertrag mit einem Anbieter abschließen – und direkt mit diesem abrechnen, nicht mehr über die Betriebskosten.
Abrechnungen für das Jahr 2024 sollten daher exakt getrennt nach Zeiträumen ausgewiesen sein. Wird dennoch der gesamte Jahresbetrag berechnet oder kein klarer Zeitraum angegeben, ist der Posten anfechtbar.
Sonstige Betriebskosten (z. B. Dachrinnenreinigung, Wartung Rauchmelder)
Der Begriff „Sonstige Betriebskosten“ taucht in vielen Abrechnungen auf – oft in Form kleinerer Einzelposten, manchmal auch als Sammelposten, hinter dem sich ganz Unterschiedliches verbergen kann. Genau deshalb lohnt sich hier ein besonders kritischer Blick, denn nicht alles, was unter dieser Kategorie auftaucht, ist auch wirklich umlagefähig.
Gesetzliche Grundlage
Die Betriebskostenverordnung listet in § 2 BetrKV insgesamt 17 zulässige Kostenarten auf. Die letzte davon – Nr. 17 – lautet:
„Sonstige Betriebskosten, die im Zusammenhang mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks stehen.“
Wichtig ist:
Solche „sonstigen“ Kostenarten müssen im Mietvertrag ausdrücklich benannt werden, sonst dürfen sie nicht auf den Mieter umgelegt werden.
Was zählt zu den „sonstigen Betriebskosten“?
Typische Beispiele, die in der Praxis immer wieder vorkommen:
- Dachrinnenreinigung
→ Umlagefähig, wenn regelmäßig durchgeführt und im Mietvertrag aufgeführt.
→ Nicht zulässig, wenn sie nur alle paar Jahre erfolgt, aber jährlich berechnet wird. - Wartung der Rauchmelder
→ Nur die Wartungskosten sind umlagefähig, nicht Anschaffung, Einbau oder Austausch.
→ Die Wartung muss fachgerecht durchgeführt und belegbar sein. - Wartung von Brandschutzanlagen (z. B. Hausalarmanlage, Feuerlöscher in Fluren)
→ Gilt als Betriebskosten, wenn gemeinschaftlich genutzt und vertraglich vereinbart. - Betriebskosten für Blitzschutzanlagen
- Wartung der Lüftungsanlage, wenn zentral vorhanden (z. B. bei innenliegenden Bädern ohne Fenster)
Was gehört NICHT zu den sonstigen Betriebskosten?
- Instandhaltung oder Reparatur von Rauchmeldern, Lüftungsanlagen oder Dachrinnen
- Einmalige Maßnahmen, z. B. der erstmalige Rückschnitt stark verwilderter Bäume
- Kosten für Handwerkerleistungen, die auf Mängel oder Schäden zurückzuführen sind
- Posten ohne Einzelnachweis, z. B. „Sonstiges“ ohne nähere Aufschlüsselung
Wartung der Rauchmelder
Rauchwarnmelder sind in den meisten Bundesländern seit Jahren gesetzlich vorgeschrieben. Doch was viele nicht wissen: Nur die Wartungskosten dürfen über die Betriebskosten abgerechnet werden – nicht Anschaffung, Einbau oder Austausch.
In vielen Fällen ist allerdings gar keine Wartung erkennbar:
- Die Geräte sind vom Hersteller als wartungsfrei für 10 Jahre deklariert.
- Niemand taucht jemals in der Wohnung auf, um eine Wartung durchzuführen.
- Es gibt keine Protokolle oder Nachweise über durchgeführte Leistungen.
In solchen Fällen ist eine Umlage nicht rechtmäßig.
Was ist mit „Fernwartung“?
Manche Wohnungsunternehmen oder Dienstleister berufen sich auf eine angeblich stattfindende Fernwartung per Funk. Diese kann theoretisch zulässig sein, aber nur dann, wenn:
- Eine entsprechende Technik tatsächlich verbaut ist (z. B. Funk-Rauchmelder mit Prüffunktion)
- Ein Nachweis über regelmäßige Fernprüfung vorliegt
- Die Kostenposition konkret im Mietvertrag genannt wird
Fehlt einer dieser Punkte, ist die Umlage der Wartungskosten nicht zulässig.
Fazit
Keine erbrachte Leistung = keine Betriebskosten.
Mieter dürfen immer einen Nachweis über die durchgeführte Wartung verlangen. Ohne diesen Nachweis (egal ob durch Vor-Ort-Prüfung oder Funkprotokoll) ist die Abrechnung anfechtbar.
Zudem ist entscheidend, ob der Mietvertrag die Wartung ausdrücklich aufführt. Allgemeine Klauseln wie „Sonstige Betriebskosten“ reichen nicht aus.
Achtung bei Pauschalen
Oft wird z. B. für die Wartung der Rauchmelder eine Pauschale verlangt – etwa 10 bis 15 € jährlich pro Wohnung.
Solche Pauschalen sind nur zulässig, wenn sie einem konkreten, regelmäßig erbrachten Service entsprechen – etwa einem jährlichen Wartungsvertrag mit einem Fachunternehmen.
Fehlt dieser Nachweis oder wurde die Leistung gar nicht erbracht, ist die Umlage nicht zulässig.
Was muss im Mietvertrag stehen?
Bei „sonstigen Betriebskosten“ ist besondere Sorgfalt gefragt. Der Mietvertrag muss:
- Konkret aufführen, welche sonstigen Kosten gemeint sind (z. B. „Wartung Rauchwarnmelder“ oder „Pflege Blitzschutzanlage“)
- Allgemeine Formulierungen wie „sonstige Kosten laut Betriebskostenverordnung“ reichen nicht aus
- Eine nachträgliche Ergänzung durch den Vermieter ist nicht möglich
Fazit
„Sonstige Betriebskosten“ sind kein Freifahrtschein für beliebige Zusatzkosten.
Nur wenn klare, nachvollziehbare Leistungen vertraglich benannt sind und regelmäßig erbracht werden, ist die Umlage rechtens.
Fehlt eine klare Grundlage oder wurde eine Leistung gar nicht erbracht, ist der Posten anfechtbar.
Was NICHT umgelegt werden darf
Wer sich eine Betriebskostenabrechnung ansieht, hat oft das Gefühl: Alles, was dem Vermieter irgendwie Kosten verursacht, wird einfach an die Mieter weitergereicht. Dabei ist die Sache juristisch eindeutig: Nur bestimmte Kostenarten dürfen überhaupt umgelegt werden – nämlich jene, die laufend entstehen, der Bewirtschaftung des Gebäudes dienen und ausdrücklich im Mietvertrag genannt sind.
Doch viele Abrechnungen enthalten Posten, die dort nichts zu suchen haben. Ob Verwaltung, Reparaturen oder Nebenkosten aus leerstehenden Wohnungen – es gibt klare Grenzen, was umlagefähig ist und was nicht.
Und genau deshalb lohnt sich der genaue Blick: Denn was der Vermieter in die Abrechnung schreibt, ist noch lange nicht rechtens.
Typische unzulässige Posten (inkl. Beispielen)
Viele Vermieter setzen darauf, dass Mieter die Betriebskostenabrechnung einfach durchwinken. Und so finden sich dort regelmäßig Posten, die nach geltendem Mietrecht nicht umlagefähig sind – obwohl sie dennoch abgerechnet werden. Teilweise aus Unwissenheit, teilweise in der Hoffnung, dass es niemand merkt. Hier sind die häufigsten „Klassiker“:
Verwaltungskosten
Verwaltungskosten dürfen niemals über die Betriebskosten umgelegt werden – das gilt ausdrücklich auch dann, wenn sie im Mietvertrag stehen sollten. Dazu zählen u. a.:
- Gehälter der Hausverwaltung
- Porto und Bürobedarf
- Buchführung und Abrechnungsaufwand
- Kosten für Eigentümerversammlungen (bei WEGs)
Beispiel:
In der Abrechnung taucht eine Position „Verwaltungsaufwand 65 €“ auf – das ist unzulässig und darf nicht bezahlt werden.
Instandhaltung und Reparaturen
Kosten für die Instandhaltung des Gebäudes oder Reparaturen an Anlagen sind grundsätzlich Sache des Vermieters. Diese zählen zu den „nicht umlagefähigen Bewirtschaftungskosten“. Dazu gehören z. B.:
- Reparatur einer defekten Heizungsanlage
- Austausch defekter Treppenhauslampen
- Instandsetzung von Fenstern oder Türen
- Erneuerung einer defekten Gegensprechanlage
Ausnahme:
Nur die regelmäßige Wartung (z. B. der Heizung) kann umlagefähig sein – nicht deren Reparatur.
Kosten für leerstehende Wohnungen
Auch das kommt immer wieder vor: Die Betriebskosten für leerstehende Wohnungen werden auf die bewohnten Einheiten aufgeteilt, obwohl der Vermieter sie selbst zu tragen hätte.
Beispiel:
Eine Heizkostenabrechnung enthält einen „Verteilerschlüssel“, der leerstehende Wohnungen ignoriert – die übrigen Mieter zahlen also mit. Das ist rechtswidrig, sofern keine Ausnahme (z. B. bei verbrauchsabhängiger Messung) gegeben ist.
Einmalige oder nicht laufende Kosten
Betriebskosten müssen laufend entstehen – das ist gesetzlich so definiert. Einmalige Sonderausgaben dürfen daher nicht über die Betriebskosten abgerechnet werden.
Beispiele für unzulässige Einzelfälle:
- Anschaffung eines neuen Müllcontainers
- Kosten für den Austausch eines defekten Heizkessels
- Einbau einer neuen Haustür
- Baumschnitt als Reaktion auf Sturmschäden
Diese Kosten sind dem Vermieter zuzurechnen – und dürfen nicht auf die Mieter abgewälzt werden.
Anschaffungskosten von Anlagen und Geräten
Die Anschaffung (Kauf) von Dingen wie Rauchmeldern, Klingelanlagen oder Gartenwerkzeug ist nicht umlagefähig. Nur die laufende Wartung oder Pflege (wenn vertraglich geregelt) kann als Betriebskosten angesetzt werden.
Beispiel:
„Rauchwarnmelder 80 € (Kauf und Einbau)“ ist nicht umlagefähig. Wird dennoch abgerechnet, lohnt sich ein Widerspruch.
Kosten für Sonder- oder Zusatzdienste
Einige Vermieter beauftragen zusätzlich zum regulären Betrieb z. B.:
- Sicherheitsdienste zur Überwachung des Objekts
- Objektbetreuer, die regelmäßig durchs Treppenhaus laufen
- Wachpersonal bei leerstehenden Gewerbeeinheiten
Diese Kosten sind nicht umlagefähig, sofern sie nicht im Mietvertrag klar benannt wurden und nicht zur gewöhnlichen Gebäudebewirtschaftung gehören.
Verdeckte Kosten in anderen Posten
Ein besonders ärgerlicher Trick: Kosten werden einfach in scheinbar zulässigen Posten „versteckt“ – zum Beispiel:
- Reparaturkosten in der Hauswartpauschale
- Verwaltungskosten im Posten „Allgemeine Betriebskosten“
- Vertragsgebühren im „Kabelanschluss“
Hier hilft nur eins: Belegeinsicht verlangen und den Posten im Zweifel beanstanden.
Fazit:
Nicht alles, was berechnet wird, darf berechnet werden.
Mieter haben das Recht – und manchmal auch die Pflicht – kritisch nachzufragen. Nur so lässt sich verhindern, dass aus der Nebenkostenabrechnung eine stille Mieterhöhung durch die Hintertür wird.
Gerichtsurteile zu häufigen Streitpunkten
Theorie ist gut – aber was zählt, ist, was Gerichte sagen. Denn viele Fragen rund um Betriebskosten sind nicht im Gesetz im Detail geregelt, sondern wurden durch Urteile geklärt. Die Rechtsprechung hilft dabei, unzulässige Abrechnungen zu erkennen – und sich erfolgreich dagegen zu wehren.
Hier eine Auswahl besonders relevanter Streitfälle:
Instandhaltungskosten auf Mieter umgelegt? – Unzulässig!
Leitsatz:
Reparatur- und Instandhaltungskosten dürfen nicht über die Betriebskosten abgerechnet werden – auch nicht teilweise.
Beispiel:
Ein Vermieter hatte eine kaputte Pumpe in der Heizungsanlage austauschen lassen und die Kosten als „Wartung Heizungsanlage“ abgerechnet. Das Amtsgericht München entschied: Nicht umlagefähig.
Urteil:
AG München, Urteil vom 06.04.2011, Az.: 412 C 11503/10
Verwaltungskosten auf der Abrechnung? – Ganz klar verboten
Leitsatz:
Verwaltungskosten sind ausdrücklich nicht umlagefähig – auch nicht über Umwege.
Beispiel:
Ein Vermieter hatte unter „sonstige Betriebskosten“ auch Kosten für Buchhaltung, Porto und Abrechnungssoftware versteckt. Das Amtsgericht Leipzig stellte klar: Diese Posten sind rechtswidrig.
Urteil:
AG Leipzig, Urteil vom 24.08.2009, Az.: 164 C 6043/09
Hauswart mit unklarer Tätigkeit? – Nur nachweisbare Leistungen zählen
Leitsatz:
Die Kosten für einen Hausmeister sind nur dann umlagefähig, wenn die Tätigkeiten konkret belegt und zulässig sind.
Beispiel:
Ein Vermieter berechnete 3.600 € jährlich für einen Hauswart. Es stellte sich heraus, dass dieser hauptsächlich Verwaltungsaufgaben übernommen hatte – und kaum typische Hausmeistertätigkeiten.
Urteil:
LG Berlin, Urteil vom 14.04.2011, Az.: 67 S 502/10
Sperrmüll nach Auszug anderer Mieter? – Keine Umlage auf die Hausgemeinschaft
Leitsatz:
Kosten für einmalige Sonderleistungen wie die Räumung einer Wohnung oder Sperrmüll nach Auszug sind nicht umlagefähig, wenn sie nicht regelmäßig anfallen.
Beispiel:
Ein Vermieter hatte nach dem Auszug einer Mietpartei deren zurückgelassenen Hausrat entsorgen lassen – und die Kosten auf alle Mieter verteilt. Das Gericht stoppte das: Keine Betriebskosten, sondern Einzelfall.
Urteil:
AG Köln, Urteil vom 08.03.2005, Az.: 222 C 426/04
Rauchmelder-Kosten: Anschaffung nein, Wartung ja – aber nur mit Nachweis
Leitsatz:
Nur die Wartungskosten für Rauchmelder sind umlagefähig – nicht die Anschaffung oder der Einbau.
Beispiel:
Ein Vermieter legte jährlich 28 € je Wohnung für „Rauchwarnmelder-Service“ um – obwohl nie jemand zur Wartung erschien. Das Gericht urteilte: Ohne Nachweis über tatsächliche Wartung nicht zulässig.
Urteil:
AG Hamburg, Urteil vom 02.02.2017, Az.: 49 C 300/15
Kabelanschluss nach der TKG-Novelle: Umlage seit Juli 2024 unzulässig
Leitsatz:
Seit dem 1. Juli 2024 dürfen die Kosten für den Kabelanschluss nicht mehr über die Betriebskosten abgerechnet werden – unabhängig davon, ob Mieter das Angebot nutzen oder einen eigenen Vertrag abgeschlossen haben.
Hintergrund:
Die sogenannte „Nebenkostenprivileg“-Regelung wurde mit der Telekommunikationsgesetz-Novelle (TKG) im Dezember 2021 abgeschafft. Vermieter durften den Kabelanschluss zwar noch bis 30. Juni 2024 über die Betriebskosten abrechnen, doch seit dem 1. Juli 2024 ist damit Schluss.
Was bedeutet das konkret?
- Eintragungen wie „Kabel/Multimedia“, „Gemeinschaftsantennenanlage“ oder ähnliche Bezeichnungen sind seit Juli 2024 nicht mehr zulässig – auch dann nicht, wenn im Mietvertrag eine entsprechende Klausel steht.
- Die Umstellung erfolgte automatisch per Gesetz – eine Kündigung des bisherigen Sammelvertrags durch den Mieter war nicht erforderlich.
- Wer weiterhin Kabelfernsehen nutzen möchte, muss nun selbst einen Einzelvertrag mit dem Anbieter abschließen.
Rechtsgrundlage:
– § 2 Abs. 2 Satz 1 TKG (n. F.)
– Art. 229 § 60 EGBGB (Übergangsvorschrift)
– BT-Drs. 19/26108 (Begründung zur Gesetzesänderung)
Fristversäumnis: Abrechnung zu spät? – Nachzahlung entfällt
Leitsatz:
Wenn die Betriebskostenabrechnung nicht spätestens bis zum 31.12. des Folgejahres zugestellt wird, darf der Vermieter keine Nachforderungen mehr stellen.
Urteil:
BGH, Urteil vom 08.04.2009, Az.: VIII ZR 86/08
Wichtig:
Diese Regel gilt auch dann, wenn der Vermieter selbst keine Schuld an der Verspätung trägt (z. B. wegen Steuerberater).
Fazit:
Viele Streitpunkte wiederholen sich – und die Gerichte urteilen meist eindeutig. Wer seine Rechte kennt und unzulässige Posten erkennt, hat gute Chancen, sich gegen fehlerhafte Abrechnungen zu wehren. Dabei helfen nicht nur Gesetze, sondern auch zahlreiche gerichtlich bestätigte Urteile, die sich auf vergleichbare Fälle übertragen lassen.
Häufige Streitfälle aus der Praxis
In der Theorie ist vieles klar geregelt: Die Betriebskostenverordnung listet exakt auf, was umgelegt werden darf – und was nicht. Doch in der Praxis sieht es oft anders aus. Immer wieder tauchen in Abrechnungen Posten auf, die bei genauerem Hinsehen fragwürdig, überzogen oder schlicht unzulässig sind.
Einige dieser Fälle wiederholen sich dabei auffallend häufig – quer durch alle Regionen, Vermieterstrukturen und Mietverhältnisse. Ob Sperrmüll durch Dritte, ein nicht vorhandener Hausmeister oder überteuerte Gartenpflege: Wer seine Abrechnung prüft, entdeckt schnell Auffälligkeiten, die sich nicht mehr mit „normalen Betriebskosten“ erklären lassen.
In diesem Kapitel werfen wir einen Blick auf genau solche Beispiele aus dem Alltag. Keine Einzelfälle, sondern Probleme, mit denen Tausende Mieterinnen und Mieter jedes Jahr konfrontiert werden.
Sperrmüll durch Dritte
Kaum ein Posten sorgt bei Betriebskostenabrechnungen für so viel Ärger wie der Sperrmüll. Dabei geht es nicht etwa um regelmäßig geplante Entsorgungen, sondern um außerplanmäßige Räumaktionen – häufig verursacht durch einzelne Mieter, die ihren Müll einfach zurücklassen oder ihren „Hausstand“ auf dem Gehweg entsorgen. In solchen Fällen stellt sich schnell die Frage: Müssen alle anderen wirklich dafür aufkommen?
Typischer Fall: Rückstandsentsorgung nach Auszug
Besonders häufig kommt es zu hohen Kosten, wenn ehemalige Mieter beim Auszug Mobiliar, Müllsäcke oder Elektrogeräte in der Wohnung, im Keller oder auf dem Grundstück zurücklassen. Die Entsorgung dieser Hinterlassenschaften wird dann oft als „Sperrmüll“ oder „Räumungskosten“ in der Betriebskostenabrechnung aufgeführt – verteilt auf alle übrigen Mieter.
Problematisch daran:
Diese Kosten sind nicht umlagefähig, wenn sie nicht regelmäßig und allgemein anfallen, sondern konkret durch ein individuelles Fehlverhalten (z. B. eine Messie-Wohnung oder eine Nacht-und-Nebel-Aktion beim Auszug) verursacht wurden.
Was sagt die Rechtsprechung?
Gerichte haben wiederholt klargestellt:
Einzelne, anlassbezogene Entsorgungskosten, die nicht laufend entstehen, dürfen nicht auf alle Mieter umgelegt werden.
- Beispiel: Wenn ein Mieter beim Auszug Sperrmüll hinterlässt, darf der Vermieter die Entsorgungskosten nicht als Betriebskosten absetzen, sondern muss sie individuell gegen den Verursacher geltend machen – auch wenn dieser finanziell nicht greifbar ist.
LG Berlin, Urteil vom 14.04.2005 – 67 S 416/04:
„Die Entsorgung von Müll einzelner Mieter ist keine Betriebskostenposition im Sinne der Betriebskostenverordnung.“
Oft getarnter Posten
Ein häufiger Trick: Statt als „Sperrmüll“ wird der Posten unter allgemeinen Bezeichnungen wie „Gartenpflege“, „Müllabfuhr“, „Hauswart“ oder „Reinigung Außenanlagen“ versteckt.
Auch Formulierungen wie „Sonderreinigung“ oder „Entsorgungskosten Block XY“ sollen verschleiern, dass es sich nicht um umlagefähige Regelkosten, sondern um Einzelfälle handelt.
Was du tun kannst
- Auffällige Einzelpositionen anfechten: Taucht ein Sperrmüll-Posten nur einmalig auf – z. B. mit Ortsangabe wie „Musterstraße 10“ – ist das ein klares Indiz für eine nicht umlagefähige Einzelmaßnahme.
- Belegeinsicht verlangen: Fordere die konkrete Rechnung an und achte auf Begriffe wie „Räumung“, „Sonderentsorgung“ oder explizite Wohnungsangaben.
- Hinweis auf Verursacher verlangen: Wenn der Vermieter weiß, wer den Müll verursacht hat, muss er diesen direkt zur Kasse bitten – nicht die übrigen Mieter.
Hausmeister ohne Tätigkeit
Der Posten „Hausmeister“ oder „Hauswart“ taucht in vielen Betriebskostenabrechnungen auf – oft mit dreistelligen Beträgen pro Jahr und Mieter. Und das selbst dann, wenn niemand weiß, wer dieser Hausmeister eigentlich ist, geschweige denn, was er konkret tut.
Denn Fakt ist: In vielen Wohnanlagen gibt es gar keinen Hausmeister im eigentlichen Sinne mehr. Stattdessen werden Aufgaben an externe Dienstleister ausgelagert oder zentral über Service-Hotlines abgewickelt. Trotzdem bleibt der Kostenpunkt bestehen – und sorgt regelmäßig für Streit.
Was zählt überhaupt zur Hausmeistertätigkeit?
Grundsätzlich dürfen nur laufende, regelmäßig anfallende Aufgaben des Hausmeisters über die Betriebskosten abgerechnet werden. Dazu gehören zum Beispiel:
- kleine Reparaturen im Haus (z. B. Leuchtmittel austauschen)
- Kontrolle technischer Anlagen
- Koordination von Handwerkern
- Überwachung des Hauszustands (Mängel melden)
- kleinere Reinigungsarbeiten (soweit nicht gesondert abgerechnet)
Nicht umlagefähig sind hingegen:
- Verwaltungsaufgaben (z. B. Abrechnungen erstellen, Schriftverkehr)
- Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. Austausch defekter Geräte)
- Reparaturen und bauliche Arbeiten
- Leerstandsbetreuung oder Wohnungsabnahmen
Was sagt die Rechtsprechung?
Mehrere Urteile haben deutlich gemacht, dass die bloße Nennung eines Hausmeisters nicht ausreicht, um Kosten umzulegen. Es muss klar erkennbar sein, welche Tätigkeiten konkret erbracht wurden – und dass diese umlagefähig sind.
AG Köln, Urteil vom 15.01.2013 – 205 C 362/12:
„Ein Hausmeister muss nicht nur existieren, sondern auch eine Leistung im Sinne der Betriebskostenverordnung erbringen.“
LG Berlin, Urteil vom 22.06.2010 – 63 S 501/09:
„Verwaltungstätigkeiten dürfen nicht auf Mieter umgelegt werden, auch wenn sie vom Hauswart ausgeführt wurden.“
Abrechnung auf gut Glück?
Oft wird in der Abrechnung ein Pauschalbetrag pro Einheit oder Quadratmeter angesetzt – ohne Auflistung, wann und wo der Hauswart tätig war. Noch fragwürdiger wird es, wenn es nachweislich keinen festen Hausmeister mehr gibt, sondern nur eine Service-Nummer, bei der man sich melden muss – mit teilweise wochenlangen Wartezeiten auf einen Termin.
In solchen Fällen gilt:
Hausmeisterkosten sind nur dann umlagefähig, wenn sie tatsächlich erbracht und korrekt abgerechnet wurden.
Was du tun kannst
- Rechenschaft fordern: Du hast ein Recht zu erfahren, was genau abgerechnet wird – inklusive Tätigkeitsnachweisen.
- Belegeinsicht verlangen: Lass dir aufschlüsseln, ob und wann der Hauswart tätig war – und was genau gemacht wurde.
- Zweifelhafte Posten anfechten: Wird keine Leistung nachgewiesen, darf auch keine Umlage erfolgen.
Gartenpflege zum Abwinken
Kaum ein Posten in der Betriebskostenabrechnung sorgt für so viel Unmut wie die Gartenpflege. Während mancherorts lediglich alle paar Wochen der Rasen gestutzt wird, erscheinen auf der Abrechnung hohe dreistellige Summen, die angeblich für eine professionelle Pflege der Außenanlagen angefallen sind.
Doch oft fragt man sich als Mieter: Wofür genau bezahle ich hier eigentlich?
Was zur Gartenpflege gehört – und was nicht
Zulässig sind laut Betriebskostenverordnung (§ 2 Nr. 10 BetrKV) die laufenden Kosten der Pflege von gärtnerisch angelegten Flächen. Dazu zählen:
- regelmäßiges Rasenmähen
- Heckenschnitt und Rückschnitt von Büschen
- Entfernen von Unkraut auf Grünflächen oder Wegen
- Pflege von Blumenbeeten
- Laubentfernung im Herbst
Nicht umlagefähig sind hingegen:
- Neuanlagen von Gärten oder Beeten
- Ersatz oder Neupflanzung größerer Bäume oder Sträucher
- Reparaturen an Einfassungen, Zäunen oder Wegen
- Tätigkeiten, die nur bei Neubau oder Sanierung anfallen
Wichtig ist: Es muss sich um regelmäßig wiederkehrende Arbeiten handeln – nicht um Einzelmaßnahmen oder Instandsetzungen.
248 € für ein paar Runden mit dem Aufsitzmäher?
In vielen Fällen ist die Gartenpflege nicht ausgelagert, sondern wird von hausinternen Mitarbeitern erledigt – die jedoch in kürzester Zeit mit motorisiertem Gerät den Rasen „pflegen“ und dabei keine Rücksicht auf Boden oder Wetter nehmen. Was nach fünf Minuten erledigt ist, taucht dann als Kostenpunkt von mehreren hundert Euro auf der Abrechnung auf.
Dabei ist es völlig legitim, kritisch nachzufragen, wenn:
- die Arbeiten nicht erkennbar oder nachweisbar sind
- Hecken jahrelang nicht geschnitten wurden
- der Rasen maximal 4–5 Mal pro Jahr gemäht wurde
- keine Pflege an erkennbaren Beeten oder Strukturen stattfindet
Viele Mieter berichten zudem, dass der Rasen eher zerstört als gepflegt aussieht – vor allem wenn bei aufgeweichtem Untergrund mit schweren Geräten gefahren wird.
Was ist mit der „Baumpflege“?
Oft wird ein zweiter Posten „Gartenpflege Baumpflege“ separat aufgeführt – meist mit kleinen Beträgen. Darunter fallen gelegentliche Maßnahmen wie:
- Entfernen abgestorbener Äste
- Rückschnitt bei Überwuchs
- Verkehrssicherungspflicht bei morschen Bäumen
Solche Arbeiten sind grundsätzlich umlagefähig, wenn sie tatsächlich durchgeführt wurden. Wenn jedoch über Jahre keine erkennbare Maßnahme erfolgt, ist auch dieser Posten kritisch zu hinterfragen.
Gerichtsurteile zur Gartenpflege
AG Leipzig, Urteil vom 05.06.2013 – 164 C 7341/12:
„Gartenpflegekosten müssen nachvollziehbar und aufgeschlüsselt sein. Pauschale Angaben ohne tatsächliche Leistungen genügen nicht.“
AG Brandenburg, Urteil vom 15.02.2011 – 31 C 255/10:
„Mieter müssen Gartenpflege nicht bezahlen, wenn diese nur auf dem Papier existiert.“
Was du tun kannst
- Belegeinsicht verlangen: Lass dir zeigen, wer wann was gemacht hat – und wie die Kosten berechnet wurden.
- Fotos und Notizen machen: Ist der Rasen überwuchert oder die Hecke meterhoch? Dokumentiere das.
- Nachbarn ansprechen: Oft erleben mehrere Parteien das Gleiche – gemeinsam ist man schlagkräftiger.
- Widerspruch einlegen, wenn die Kosten nicht plausibel sind oder Maßnahmen offensichtlich fehlen.
Winterdienst ohne Schnee
Ein Klassiker unter den fragwürdigen Betriebskosten: Der Winterdienst – abgerechnet als fester Posten, egal ob es im Winter geschneit hat oder nicht. Dabei stellt sich die Frage: Wie kann es sein, dass Jahr für Jahr ein dreistelliger Betrag berechnet wird, obwohl in vielen Regionen nicht einmal eine Schneeflocke gefallen ist?
Was zählt eigentlich zum Winterdienst?
Laut Betriebskostenverordnung (§ 2 Nr. 8 BetrKV) dürfen die laufenden Kosten für die Schnee- und Glättebeseitigung umgelegt werden. Dazu gehört:
- Räumen von Gehwegen, Zuwegungen und Hauseingängen
- Streuen bei Glätte
- Einsatz von Personal oder beauftragten Firmen
- Materialkosten für Streugut (z. B. Sand oder Granulat)
- Kosten für Fahrzeuge (z. B. kleine Räumtraktoren), wenn sie gemietet oder für den Winterdienst eingesetzt werden
Aber: Es handelt sich um laufende Betriebskosten – das bedeutet, nur tatsächlich erbrachte Leistungen dürfen berechnet werden.
Immer zahlen – auch wenn nichts passiert?
Ein häufiger Trick: Vermieter beauftragen pauschal einen Winterdienstvertrag für die gesamte Saison – unabhängig davon, ob ein Einsatz erfolgt oder nicht. Das Argument: Man müsse ja jederzeit einsatzbereit sein.
Doch Gerichte sehen das differenzierter:
BGH, Urteil vom 10.02.2016 – VIII ZR 33/15:
„Kosten für eine beauftragte Firma dürfen umgelegt werden, auch wenn es in einem milden Winter zu wenigen oder keinen Einsätzen kam – sofern eine konkrete Leistungsbereitschaft bestand und dies vertraglich geregelt ist.“
Das heißt: Ein pauschaler Bereitschaftsdienst kann zulässig sein – aber nur, wenn es einen Nachweis gibt, dass die Firma tatsächlich in Bereitschaft war, z. B. durch einen Vertrag oder Einsatzprotokolle. Auch bei sporadischem Einsatz muss dokumentiert werden, wann, wo und wie lange gearbeitet wurde.
Und in der Realität?
Viele Mieter berichten: Selbst bei Glätte und Schnee kommt oft niemand. Stattdessen werden die Gehwege von den Mietern selbst oder gar nicht geräumt – trotzdem steht der Winterdienst als voller Betrag auf der Abrechnung.
Dabei gilt: Der öffentliche Gehweg vor dem Haus fällt in den Verantwortungsbereich der Stadt – es sei denn, der Eigentümer wurde durch Satzung verpflichtet. In diesem Fall kann der Vermieter einen Winterdienst beauftragen, dessen Kosten dann auf die Mieter umgelegt werden – aber nur für das, was nicht städtisch erledigt wird.
Häufige Probleme
- Es gibt keine oder kaum Einsätze, trotzdem wird ein hoher Betrag berechnet.
- Keine Einsicht in Verträge oder Einsatznachweise.
- Räumarbeiten werden durch Mieter oder Nachbarn erledigt – trotzdem werden Dienstleister abgerechnet.
- Abrechnung erfolgt pauschal, obwohl tatsächliche Einsätze fehlen.
Was du tun kannst
- Belegeinsicht verlangen: Lass dir Verträge, Einsatzprotokolle oder Rechnungen zeigen.
- Dokumentieren: Wann wurde wirklich geräumt oder gestreut? Mach Fotos oder führe ein Wintertagebuch.
- Nachbarn fragen: Auch hier gilt: Gemeinsam lässt sich leichter beweisen, dass nichts passiert ist.
- Widerspruch einlegen, wenn der Winterdienst nicht oder kaum erkennbar war.
Merke
Winterdienstkosten dürfen nur dann abgerechnet werden, wenn sie tatsächlich angefallen oder vertraglich begründet sind. Eine pauschale Abrechnung „zur Sicherheit“ ist nicht zulässig – erst recht nicht, wenn kein Schnee lag und kein Einsatz stattfand.
Gebäudeversicherung: Was wirklich dazugehört
Die Gebäudeversicherung zählt zu den typischen Betriebskosten, die Vermieter auf Mieter umlegen dürfen – doch was viele nicht wissen: Nicht jede Versicherungsart, die mit dem Gebäude zu tun hat, ist automatisch umlagefähig. Hier lohnt es sich genau hinzusehen.
Was ist eine Gebäudeversicherung?
Die Gebäudeversicherung sichert das Wohngebäude gegen bestimmte Gefahren ab – meist im Rahmen einer sogenannten verbundenen Wohngebäudeversicherung. Dazu gehören typischerweise:
- Feuer (z. B. Brand, Blitzschlag, Explosion)
- Leitungswasser (z. B. Rohrbruch)
- Sturm und Hagel
- Elementarschäden (optional, z. B. Überschwemmung, Erdbeben)
Diese Versicherung ist für den Vermieter verpflichtend, kann aber über die Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden, sofern dies im Mietvertrag vereinbart ist.
Umlagefähige Bestandteile
Laut § 2 Nr. 13 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) zählen zu den umlagefähigen Kosten:
„[…] die Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, Wasser- sowie sonstige Elementarschäden.“
Auch Glasversicherung, Gebäudehaftpflicht oder eine Öltankversicherung können umlagefähig sein, wenn sie konkret dem Schutz des Gebäudes dienen und ebenfalls vertraglich geregelt sind.
Nicht umlagefähige Versicherungen
Nicht auf die Mieter umgelegt werden dürfen dagegen:
- Hausratversicherung des Vermieters
- Rechtsschutzversicherung
- Mietausfallversicherung
- Gebäudebewertung oder Wertermittlung
- Bauherrenhaftpflicht
Diese Versicherungen betreffen ausschließlich das wirtschaftliche Interesse des Eigentümers und haben keinen direkten Nutzen für die Mieter. Sie gehören daher zu den Verwaltungskosten – und die sind nicht umlagefähig (§ 1 Abs. 2 BetrKV).
Was sollte in der Abrechnung stehen?
Eine korrekte Betriebskostenabrechnung muss die Versicherungsarten einzeln aufführen. Ein bloßer Sammelposten wie „Versicherung allgemein“ ist nicht ausreichend. Du hast Anspruch auf:
- Klar erkennbare Zuordnung der Versicherung (z. B. Gebäude, Haftpflicht etc.)
- Gesamtkosten
- Deinen Umlageanteil
- Einsicht in die Originalrechnung auf Nachfrage
Häufige Probleme
- Mischpositionen: Rechtsschutz- oder Mietausfallversicherung wird versteckt mit abgerechnet
- Fehlende Trennung: Nur ein Gesamtbetrag für alle Versicherungen
- Unplausible Summen: Mehrere hundert Euro jährlich, ohne nachvollziehbare Grundlage
- Kein Nachweis trotz Belegeinsichtsgesuch
Beispielrechnung
Angenommen:
- Die Gesamtversicherungskosten des Hauses betragen 1.680 € jährlich.
- Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten.
- Der Mieter wohnt auf 85 m², die Gesamtnutzfläche beträgt 680 m².
| Versicherungsart | Gesamtkosten | Umlagefähig | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| Wohngebäudeversicherung | 1.200 € | ✅ Ja | Umlegbar laut BetrKV § 2 Nr. 13 |
| Gebäudehaftpflicht | 200 € | ✅ Ja | Dient der allgemeinen Gebäudesicherheit |
| Mietausfallversicherung | 150 € | ❌ Nein | Dient dem Schutz des Vermieters |
| Rechtsschutzversicherung | 130 € | ❌ Nein | Verwaltungskosten |
| Gesamt umlagefähig | 1.400 € |
Berechnung für den Mieter:
Anteil = (85 m² ÷ 680 m²) × 1.400 €
Anteil = 0,125 × 1.400 € = 175,00 € jährlich
→ Dieser Betrag dürfte dem Mieter legitim in Rechnung gestellt werden – aber nur, wenn die Abrechnung korrekt aufgeschlüsselt ist und die Versicherungen wirklich nachweislich so bestehen.
Was du tun kannst
- Abrechnung prüfen: Ist der Posten aufgeschlüsselt? Wurde nur das Gebäude abgesichert?
- Belegeinsicht verlangen: Lass dir die Original-Policen zeigen
- Widerspruch einlegen, wenn unzulässige Versicherungen enthalten sind
Merke
Nur Versicherungen, die dem Erhalt des Gebäudes oder der allgemeinen Sicherheit der Mieter dienen, sind umlagefähig. Alles andere – etwa zum Schutz des Vermieters – zahlt dieser selbst.
Pauschale Angaben wie „Versicherung“ ohne nähere Erklärung sind nicht zulässig.
Deichverband, Hochwasserschutz & Co.
In manchen Betriebskostenabrechnungen taucht ein eher unscheinbarer, aber dennoch umstrittener Posten auf: Beiträge an den Deichverband oder Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen. Oft wird das unter der Rubrik „Sonstige Betriebskosten“ aufgeführt – manchmal für nur ein oder zwei Euro pro Jahr. Doch selbst geringe Beträge werfen rechtliche Fragen auf.
Worum geht’s überhaupt?
In bestimmten Regionen Deutschlands – etwa in Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern – existieren sogenannte Wasser- und Bodenverbände. Diese Körperschaften öffentlichen Rechts übernehmen Aufgaben wie:
- Instandhaltung von Deichen, Gräben und Schöpfwerken
- Maßnahmen zum Hochwasserschutz
- Pflege und Unterhaltung von Gewässern
- Grundentwässerung ländlicher Gebiete
Die Beiträge für diese Maßnahmen werden in der Regel vom Grundstückseigentümer gezahlt – also vom Vermieter. Die Frage ist jedoch: Darf dieser Betrag auf die Mieter umgelegt werden?
Rechtliche Einordnung
In der Betriebskostenverordnung (§ 2 BetrKV) tauchen Beiträge an Wasser- oder Deichverbände nicht ausdrücklich auf. Damit gelten sie als „sonstige Betriebskosten“ im Sinne von § 2 Nr. 17 BetrKV. Doch genau für diese Art von Kosten hat der Bundesgerichtshof (BGH) eine klare Regel aufgestellt:
BGH, Urteil vom 13. Februar 2008 – VIII ZR 105/07:
„Beiträge an Wasser- und Bodenverbände sind nur dann als Betriebskosten umlagefähig, wenn sie mietvertraglich ausdrücklich vereinbart und im Abschnitt über die Betriebskosten konkret aufgeführt sind.“
Anders gesagt:
✅ Zulässig, wenn:
- der Mietvertrag ausdrücklich regelt, dass Beiträge an Wasser- und Bodenverbände umgelegt werden dürfen,
und - diese Beiträge im Abschnitt über die Betriebskosten konkret und eindeutig benannt sind.
❌ Unzulässig, wenn:
- es sich um eine allgemeine Klausel wie „alle umlagefähigen Betriebskosten gemäß BetrKV“ handelt,
- oder der Posten „Deichverband“ ohne jede vertragliche Grundlage in der Abrechnung erscheint.
Was sagt dein Mietvertrag?
Viele Mieter entdecken plötzlich einen Posten wie „Deichverband: 1,08 €“ – und wundern sich, da im Mietvertrag nichts dazu steht. Doch das ist entscheidend:
- Steht der Deichverband nicht konkret im Mietvertrag,
- und gibt es keine ergänzende Vereinbarung,
darf dieser Betrag nicht auf die Mieter umgelegt werden – auch nicht anteilig oder als „sonstige Betriebskosten“.
Was du tun kannst
- Mietvertrag prüfen: Gibt es einen Abschnitt über sonstige Betriebskosten? Ist dort der Deichverband explizit genannt?
- Belegeinsicht fordern: Auch bei kleinen Beträgen steht dir Einsicht in die genaue Berechnungsgrundlage zu.
- Widerspruch einlegen: Ist der Posten nicht eindeutig geregelt, solltest du ihn schriftlich beanstanden.
Fazit
Auch wenn es sich um einen kleinen Betrag handelt – der rechtliche Anspruch ist entscheidend. Ohne klare mietvertragliche Regelung darf der Beitrag nicht umgelegt werden. Die Entscheidung des BGH hat hier für Klarheit gesorgt: Eine pauschale oder stillschweigende Umlage ist unzulässig.
Transparenzpflicht: Das Recht auf Belegeinsicht
Eine Betriebskostenabrechnung ist kein Wunschzettel. Wer von dir Nachzahlungen fordert, muss auch offenlegen, wie sich diese Beträge zusammensetzen. Denn Mieter sind keine Bittsteller – sie haben das klare Recht, Belege einzusehen, bevor sie zahlen.
Genau das regelt die sogenannte Transparenzpflicht: Der Vermieter muss dir auf Verlangen sämtliche Abrechnungsunterlagen zugänglich machen – und zwar nachvollziehbar, vollständig und zeitnah. Dazu zählen nicht nur Rechenwerke, sondern auch Originalrechnungen, Verträge, Zählerstände, Leistungsnachweise und Buchhaltungsbelege.
Doch in der Praxis sieht das oft anders aus: Einsicht wird verschleppt, verweigert oder es werden nur geschwärzte Kopien gezeigt. Manche Vermieter hoffen schlicht darauf, dass niemand nachfragt. Und viele Mieter wissen gar nicht, dass sie überhaupt ein Recht auf Einsicht haben – oder wie weit dieses geht.
In diesem Kapitel klären wir deshalb:
- Was du genau einsehen darfst,
- Wie und wo die Einsicht stattfinden muss,
- und was du tun kannst, wenn der Vermieter sich querstellt.
Denn eines ist sicher: Wer zahlt, darf auch wissen, wofür.
Was Mieter einsehen dürfen
Wenn du eine Betriebskostenabrechnung bekommst, musst du dich nicht auf die bloßen Zahlen verlassen. Du hast das gesetzlich verankerte Recht, sämtliche Unterlagen zu sehen, die zur Abrechnung geführt haben. Dieses Einsichtsrecht wurde in mehreren Urteilen bestätigt und gehört heute zur ständigen Rechtsprechung.
Doch was genau darfst du einsehen?
Diese Unterlagen musst du auf Verlangen vorgelegt bekommen:
- Originalrechnungen und Belege: Etwa die Rechnung der Reinigungsfirma, die Gärtnerrechnung, Müllgebührenbescheide oder Wartungsverträge.
- Verträge mit Dienstleistern: Wenn z. B. eine Firma mit der Hausreinigung, dem Winterdienst oder der Wartung beauftragt wurde.
- Zählerstände und Verbrauchswerte: Bei verbrauchsabhängigen Kosten (Heizung, Wasser) musst du die tatsächlichen Messwerte sehen können – inklusive Verteilungsschlüssel.
- Umlageschlüssel / Berechnungstabellen: Wie wurden die Gesamtkosten auf die Mieter verteilt? Welche Flächen wurden angesetzt? Wie viele Einheiten wohnen im Haus?
- Buchungsunterlagen: Wenn der Vermieter selbst Leistungen erbracht hat (z. B. Hausmeistertätigkeit durch eigenes Personal), sind auch interne Aufstellungen oder Lohnnachweise relevant.
- Nachweise für nicht umlagefähige Anteile: Etwa bei Versicherungen oder Hauswartleistungen, die nur anteilig umlagefähig sind – auch der nicht umlagefähige Anteil muss erkennbar abgezogen worden sein.
Kopien oder Einsichtnahme – was gilt?
Ein häufiger Streitpunkt ist die Form der Einsicht:
- Der Mieter hat keinen Anspruch auf kostenlose Kopien aller Belege.
- Der Vermieter muss aber Einsicht gewähren, z. B. in seinen Büroräumen, oder nach vorheriger Absprache an einem geeigneten Ort.
- In Ausnahmefällen (etwa bei weiter Entfernung oder fehlender Mobilität) können Kopien gegen Erstattung der Kosten verlangt werden.
💡 Tipp: Es reicht ein formloses Schreiben mit dem Satz
„Ich fordere hiermit Einsicht in alle der Betriebskostenabrechnung zugrunde liegenden Unterlagen gemäß § 556 Abs. 3 BGB.“
Rechtsprechung zum Einsichtsrecht
- BGH, Urteil vom 8. März 2006 – VIII ZR 78/05: Der Mieter darf Originalbelege einsehen, um die Abrechnung zu prüfen. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, unaufgefordert Kopien zu übersenden.
- BGH, Urteil vom 11. Februar 2009 – VIII ZR 32/08: Auch bei Abrechnung durch eine Hausverwaltung bleibt der Vermieter verantwortlich für die Belegvorlage.
- LG Berlin, Urteil vom 30. März 2017 – 67 S 7/17: Die Vorlage pauschaler Sammelrechnungen reicht nicht aus. Einzelpositionen müssen nachvollziehbar aufgeschlüsselt werden.
Was NICHT ausreicht
- Eine Liste mit zusammengefassten Kosten
- Geschwärzte oder unvollständige Belege
- Die bloße Aussage „Das ist Standard bei uns“
- Die Behauptung, Einsicht sei „nicht möglich“ wegen Datenschutz oder interner Abläufe
In all diesen Fällen kannst du dich auf dein Recht berufen – und bei hartnäckiger Verweigerung sogar die Zahlung zurückhalten oder kürzen (siehe Kapitel 6.3).
Wie und wo die Belege einzusehen sind
Das Recht auf Belegeinsicht ist nicht nur eine formale Pflichtübung für Vermieter – es ist ein zentrales Kontrollinstrument für Mieter, um die Richtigkeit der Betriebskostenabrechnung zu überprüfen. Doch wie genau läuft diese Einsichtnahme ab? Und was ist, wenn der Vermieter keine Einsicht ermöglichen will?
Wo findet die Belegeinsicht statt?
In der Regel erfolgt die Einsichtnahme in den Geschäftsräumen des Vermieters oder der Hausverwaltung. Wenn du also in einem Mietshaus einer großen Gesellschaft wohnst, kann es gut sein, dass du in ein Verwaltungsbüro eingeladen wirst – oft in einer nahegelegenen Stadt oder im Hauptsitz.
Alternativen – je nach Einzelfall:
- Persönliche Einsicht vor Ort (z. B. im Büro der Hausverwaltung)
- Einsicht an einem neutralen Ort, wenn z. B. keine Geschäftsstelle in erreichbarer Nähe ist
- Kopien gegen Kostenerstattung, falls dir die persönliche Einsicht z. B. aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist
👉 Wichtig: Der Vermieter muss einen zumutbaren Rahmen schaffen. Eine Anreise quer durch die Republik ist in der Regel nicht zumutbar – hier kann auf Übersendung von Kopien bestanden werden, auch digital.
Welche Form der Einsicht ist zulässig?
- Der Vermieter muss keine Kopien auf eigene Kosten zusenden, wenn du selbst Einsicht nehmen kannst.
- E-Mail oder PDF ist erlaubt – viele Vermieter lehnen das jedoch mit Verweis auf Datenschutz oder internen Aufwand ab. Rechtlich ist es aber nicht verboten, dir digitalisierte Belege bereitzustellen.
- Wenn du um Kopien bittest, darf der Vermieter angemessene Kostenersatz verlangen – in der Regel zwischen 25 und 50 Cent pro Seite, plus ggf. Porto.
Aber: Wenn der Vermieter dir die Belege überhaupt nicht zugänglich macht (weder persönlich noch per Kopie), dann verletzt er seine Transparenzpflicht – und das kann juristische Folgen haben (siehe Kapitel 6.3).
So läuft die Einsichtnahme typischerweise ab:
- Du forderst die Belege schriftlich an
(Beispiel: „Ich fordere hiermit Einsicht in sämtliche Abrechnungsbelege gemäß § 556 Abs. 3 BGB.“) - Der Vermieter schlägt einen Termin und Ort vor
(z. B. „Besuchen Sie uns dienstags zwischen 9 und 14 Uhr in der Geschäftsstelle XYZ.“) - Du prüfst die Unterlagen vor Ort
– mach dir Notizen oder fertige mit deinem Handy Fotos an (das darf dir nicht verboten werden!) - Du kannst Kopien anfordern, wenn dir das vor Ort nicht ausreicht – allerdings meist gegen Gebühr.
Was, wenn die Belegeinsicht verweigert wird?
Dann hast du als Mieter mehrere Möglichkeiten:
- Zahlung unter Vorbehalt oder Zurückbehaltung der Nachzahlung
- Widerspruch gegen die Abrechnung einlegen (siehe Kapitel 7)
- Rechtsberatung oder Mieterschutzbund hinzuziehen
- Gerichtlich durchsetzen, falls nötig (mehr dazu in Kapitel 9)
Rechtsprechung zur Einsichtnahme:
- BGH, Urteil vom 8. März 2006 – VIII ZR 78/05: Mieter haben ein Recht auf Einsicht in die Originalbelege – die Vorlage von Kopien ist ausreichend, wenn eine persönliche Einsicht unzumutbar ist.
- AG Münster, Urteil vom 31.10.2017 – 61 C 1644/17: Die Weigerung des Vermieters zur Belegvorlage berechtigt den Mieter, die Abrechnungskosten zurückzubehalten.
Wichtig
Auch wenn du Belegeinsicht verlangst, solltest du unbedingt die Widerspruchsfrist im Auge behalten. Denn die Einwendungsfrist nach § 556 BGB beginnt mit dem Zugang der Abrechnung – nicht erst nach Einsicht in die Belege.
Lege daher vorsorglich fristgerecht Widerspruch ein und weise darauf hin, dass du dir eine abschließende Prüfung nach Einsichtnahme vorbehältst.
Wenn der Vermieter mauert: Zurückbehaltungsrecht
Es klingt unglaublich, ist aber Alltag:
Trotz klarer Rechtslage verweigern viele Vermieter die Einsicht in Abrechnungsunterlagen – entweder ganz oder nur teilweise. Manche reagieren gar nicht erst auf entsprechende Anfragen. Andere schicken nur selektive Kopien, schwärzen Positionen oder berufen sich auf Datenschutz oder „interne Buchhaltungsvorgänge“.
Doch so läuft das nicht.
Wenn du die Abrechnung nicht prüfen kannst, weil dir Belege fehlen, darfst du als Mieter die Zahlung zurückhalten. Das ist dein gutes Recht – und nennt sich Zurückbehaltungsrecht.
Was sagt das Gesetz?
Das Zurückbehaltungsrecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt, genauer gesagt in § 273 Abs. 1 BGB:
„Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine Verbindlichkeit beruht, gegen den Gläubiger einen fälligen Anspruch, so kann er die geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird.“
Konkret heißt das:
Wenn du zahlen sollst (z. B. eine Nachforderung aus der Betriebskostenabrechnung), aber dein Anspruch auf Belegeinsicht nicht erfüllt wird, kannst du die Zahlung vorerst verweigern – bis der Vermieter seiner Pflicht nachkommt.
Bereits im Widerspruch ankündigen
Damit es später keine Missverständnisse gibt, solltest du das Zurückbehaltungsrecht schon im Widerspruch zur Abrechnung klar und ausdrücklich geltend machen. Zum Beispiel so:
„Bis zur vollständigen Einsicht in alle abrechnungsrelevanten Belege mache ich mein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 BGB geltend. Eine Zahlung erfolgt erst nach erfolgter Einsicht und abschließender Prüfung.“
Dieser Satz genügt, um dich rechtlich abzusichern – und um dem Vermieter zu zeigen, dass du weißt, was dir zusteht.
Wichtig zu wissen:
- Das Zurückbehaltungsrecht bedeutet nicht, dass du die Nachzahlung nie leisten musst – sondern nur, dass du sie bis zur vollständigen Prüfung zurückhalten darfst.
- Es schützt dich auch dann, wenn der Vermieter eine Mieterhöhung aufgrund gestiegener Betriebskosten ankündigt, aber die zugrunde liegende Abrechnung nicht belegt. In diesem Fall kannst du die Erhöhung ebenfalls zurückhalten, bis Einsicht gewährt wurde.
- Du bist durch § 273 BGB rechtlich abgesichert – sowohl gegenüber der Nachforderung als auch gegenüber einer daraus resultierenden Mieterhöhung.
- Es ist wichtig, das Zurückbehaltungsrecht schriftlich geltend zu machen (z. B. direkt im Widerspruch).
- Zahlst du hingegen einfach ohne Prüfung, kann das später als Anerkenntnis gewertet werden – und du verlierst die Möglichkeit, dich auf Fehler zu berufen.
Wenn der Vermieter trotzdem Druck macht?
Dann hilft nur eins: Ruhe bewahren und alles dokumentieren.
Am besten mit Hilfe eines Mietervereins oder einer Rechtsberatung (siehe Kapitel 9). Denn wer berechtigte Forderungen stellt, muss keine Angst vor Einschüchterung haben – auch nicht von großen Wohnungsunternehmen.
Widerspruch gegen die Abrechnung
Nicht jede Betriebskostenabrechnung ist korrekt – und nicht jede Position nachvollziehbar. Wenn dir etwas seltsam vorkommt oder dir wichtige Informationen vorenthalten werden, hast du als Mieter das Recht, Widerspruch einzulegen. Doch viele zögern: Aus Angst vor Konsequenzen, aus Unsicherheit oder weil sie glauben, der Vermieter habe sowieso das letzte Wort.
Dabei ist ein Widerspruch kein Angriff, sondern ein völlig legitimes Mittel zur Wahrung deiner Rechte. Voraussetzung ist nur, dass du Fristen einhältst und gewisse Regeln beachtest. Ein pauschales „Ich zahl das nicht“ reicht nicht aus – aber ein sachlich formulierter, fristgerechter Widerspruch bringt dich auf rechtlich sicheres Terrain.
In diesem Kapitel erfährst du:
– Wie viel Zeit du dafür hast,
– Welche Form dein Widerspruch haben sollte,
– Welche Inhalte wichtig sind,
– und worauf du sonst noch achten musst, um nicht auf den (oft teuren) Kosten sitzen zu bleiben.
Ein Mustertext für deinen Widerspruch ist natürlich auch mit dabei.
Fristen & Voraussetzungen
Frist für den Widerspruch
Gemäß § 556 Abs. 3 BGB hat der Mieter nach Zugang der Betriebskostenabrechnung 12 Monate Zeit, um Einwendungen zu erheben. Diese Frist beginnt mit dem Tag, an dem die Abrechnung dem Mieter tatsächlich zugeht, nicht mit dem Rechnungsdatum.
Beispiel:
Geht dir die Abrechnung am 5. Juli 2024 zu, kannst du bis zum 5. Juli 2025 schriftlich Widerspruch einlegen.
Wichtig: Nach Ablauf dieser Frist können keine Einwendungen mehr geltend gemacht werden – auch dann nicht, wenn die Abrechnung offensichtlich fehlerhaft ist. Wer die Frist verpasst, muss in der Regel zahlen.
Warum du trotzdem nicht zu lange warten solltest
Auch wenn gesetzlich 12 Monate Zeit bleiben:
In der Praxis wirst du oft schon nach wenigen Wochen mit Mahnungen oder sogar Inkassoschreiben konfrontiert, wenn du die geforderte Nachzahlung nicht sofort leistest.
Deshalb der dringende Rat:
- Nicht abwarten, sondern zeitnah Widerspruch einlegen.
- Idealerweise innerhalb von zwei bis vier Wochen nach Zugang der Abrechnung.
Form des Widerspruchs: So machst du es richtig
Der Widerspruch sollte in jedem Fall schriftlich erfolgen. Dabei ist es wichtig, dass du den Zugang nachweisen kannst, falls es später zu einem Streit kommt. Die sichersten Wege:
- Einschreiben mit Rückschein (oder Einwurf-Einschreiben)
- Fax mit Sendeprotokoll
- Persönliche Übergabe mit Empfangsbestätigung
⚠️ Eine normale E-Mail ist nicht rechtssicher – selbst dann nicht, wenn du eine Lesebestätigung anforderst.
Die einzige wirklich rechtssichere E-Mail-Variante wäre De-Mail, die jedoch kaum verbreitet ist.
Was sollte im Widerspruch stehen?
Ein Widerspruch muss nicht hoch juristisch formuliert sein. Es reicht, wenn du deutlich erklärst, dass du die Abrechnung in der vorliegenden Form nicht anerkennst, und z. B.:
- konkrete Posten beanstandest (z. B. Hausmeister, Müll, Versicherung etc.)
- Einsicht in die Originalbelege verlangst
- auf dein Zurückbehaltungsrecht hinweist, falls Belege nicht vorgelegt werden
Ein entsprechendes Muster für einen Widerspruch findest du in Kapitel 7.3.
Vorsicht bei „Zahlung unter Vorbehalt“
Oft wird empfohlen, trotz Einwänden zunächst zu zahlen – allerdings „unter Vorbehalt“.
Das mag rechtlich zulässig sein, ist aber praktisch riskant:
- Hat der Vermieter das Geld erst einmal, gibt es kaum noch einen Anreiz, Belegeinsicht zu gewähren oder Posten zu korrigieren.
- Rückforderungen können schwierig und langwierig werden.
- Manche Vermieter werten die Zahlung als stillschweigende Anerkennung.
Daher unser Rat:
Widerspruch einlegen – und bis zur Klärung nicht zahlen.
Ausnahme: Wenn du unsicher bist oder Druck bekommst, solltest du dich vorher mit einem Mieterverein oder Anwalt abstimmen.
Typische Fehler vermeiden
Ein Widerspruch gegen die Betriebskostenabrechnung ist dein gutes Recht – aber viele Mieter machen dabei Fehler, die im schlimmsten Fall Geld kosten oder eine Klärung erschweren. Damit dir das nicht passiert, findest du hier die häufigsten Fallstricke – und wie du sie vermeidest.
Fehler 1: Frist versäumt
Wie in Kapitel 7.1 erklärt, hast du 12 Monate Zeit, um gegen die Abrechnung Widerspruch einzulegen. Verpasst du diese Frist, bist du in der Regel an die Abrechnung gebunden – selbst wenn sie nachweislich falsch oder unvollständig ist.
💡 Tipp: Am besten sofort nach Erhalt der Abrechnung prüfen und zeitnah reagieren. Lieber zu früh als zu spät.
Fehler 2: Widerspruch nur mündlich oder per E-Mail
Ein Gespräch mit dem Vermieter oder der Hausverwaltung mag nett gemeint sein – aber mündliche Einwände zählen nicht. Auch E-Mails sind nicht rechtssicher, da du den Zugang im Zweifel nicht belegen kannst.
💡 Tipp:
Sende den Widerspruch schriftlich und nachweisbar:
- Einschreiben (Einwurf oder Rückschein)
- Fax mit Sendebericht
- Persönliche Übergabe mit Quittung
Fehler 3: Kein Hinweis auf Belegeinsicht
Viele Mieter vergessen, im Widerspruch konkret die Einsicht in die Belege zu verlangen. Doch ohne Einsicht kannst du nicht prüfen, ob die Abrechnung korrekt ist. Der Vermieter ist gesetzlich verpflichtet, dir diese Einsicht zu ermöglichen (§ 259 BGB, § 556 Abs. 3 BGB).
💡 Tipp:
Fordere im Widerspruch ausdrücklich die Einsicht in die Originalrechnungen, Verträge und Verteilungsschlüssel.
Fehler 4: Kein Hinweis auf das Zurückbehaltungsrecht
Wenn du eine unklare oder zweifelhafte Abrechnung bekommst, musst du nicht einfach zahlen. Nach § 273 BGB steht dir das sogenannte Zurückbehaltungsrecht zu – bis der Vermieter die geforderten Nachweise vorlegt.
💡 Tipp:
Formuliere im Widerspruch deutlich, dass du „von deinem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machst, solange keine vollständige Belegprüfung möglich ist“ – das gilt auch für mögliche Mieterhöhungen aufgrund von Betriebskosten.
Fehler 5: Unklare oder zu pauschale Formulierungen
Ein Satz wie „Ich bin mit der Abrechnung nicht einverstanden“ ist zwar ein Anfang – reicht aber nicht. Wenn du nichts Konkretes beanstandest, kann der Vermieter behaupten, du hättest dich nicht ausreichend geäußert.
💡 Tipp:
Benenne die Posten, die dir unklar erscheinen oder falsch vorkommen – zum Beispiel:
- „Die Position Hausmeister erscheint mir unangemessen, da kein entsprechender Service erbracht wurde.“
- „Ich beanstande die angesetzten Kosten für Sperrmüll, da diese nicht von mir verursacht wurden.“
Je konkreter, desto besser.
Fehler 6: Zahlung unter Vorbehalt – ohne Not
Wie schon in Kapitel 7.1 erläutert, ist eine Zahlung unter Vorbehalt nicht grundsätzlich falsch, kann aber problematisch sein. Wer einmal zahlt, bekommt sein Geld oft nur schwer zurück. Manche Vermieter versuchen dann, eine Art stillschweigende Zustimmung daraus abzuleiten.
💡 Tipp:
Lass dich nicht unter Druck setzen – besonders nicht durch pauschale Mahnungen.
Widerspruch einlegen, Belegeinsicht verlangen, und bei Bedarf professionelle Hilfe suchen.
Fehler 7: Kein Nachweis über den Zugang
Ob dein Schreiben angekommen ist oder nicht, kann im Streitfall entscheidend sein. Wer einfach einen Brief verschickt oder nur eine E-Mail schickt, hat im Zweifel das Nachsehen.
💡 Tipp:
Immer mit Zugangsnachweis arbeiten – sonst heißt es später: „Ihr Schreiben ist nie angekommen.“
Fazit: Gut vorbereitet ist halb gewonnen
Ein Widerspruch muss keine Wissenschaft sein – aber er sollte klar, nachvollziehbar und rechtssicher formuliert sein. Mit der richtigen Herangehensweise sicherst du dir nicht nur dein Recht, sondern auch die Möglichkeit, unnötige Kosten abzuwehren oder sogar Geld zurückzubekommen.
Mustervorlage für den Widerspruch
Du möchtest gegen deine Betriebskostenabrechnung Widerspruch einlegen, weißt aber nicht genau, wie du das am besten formulierst? Kein Problem! Hier bekommst du eine rechtssichere, verständliche und individualisierbare Mustervorlage, die du an deine Situation anpassen kannst.
Hinweis: Die Vorlage ersetzt keine Rechtsberatung, ist aber als erste Orientierung gut geeignet. Im Zweifel: Mieterverein oder Fachanwalt hinzuziehen.
Vor- und Nachname
Straße und Hausnummer
PLZ Ort
An
[Name des Vermieters / der Hausverwaltung]
[Adresse des Vermieters / der Hausverwaltung]
Ort, Datum
Betreff: Widerspruch gegen die Betriebskostenabrechnung für das Jahr [Jahreszahl] zur Wohnung [Adresse, ggf. Mietvertragsnummer]
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen die Betriebskostenabrechnung vom [Datum der Abrechnung] für das Abrechnungsjahr [Jahr] ein.
Nach eingehender Prüfung der Abrechnung bestehen erhebliche Zweifel an der Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit einzelner Positionen. Unter anderem beanstande ich folgende Punkte:
– [Beispiel:] Hausmeisterkosten: In der betreffenden Liegenschaft ist kein Hausmeister tätig. Ein entsprechender Dienst wurde nicht erbracht.
– [Beispiel:] Sperrmüll: Die angesetzten Kosten entstanden nicht durch mich oder mein Verschulden. Eine Umlage ist daher nicht zulässig.
– [Beispiel:] Gartenpflege: Die Häufigkeit und Art der Maßnahmen erscheint nicht verhältnismäßig zur Höhe der berechneten Kosten.
Ich fordere Sie hiermit auf, mir Einsicht in die vollständigen Belege, Rechnungen und Verteilungsschlüssel zu gewähren. Dies umfasst insbesondere:
– Originalrechnungen
– Verträge mit Dienstleistern
– Nachweise zur Umlagefähigkeit
– Aufstellung der Miteigentümer bzw. Nutzeranteile (bei Mehrparteienhäusern)
Die Einsicht kann entweder durch Übersendung von Kopien oder durch persönliche Einsichtnahme vor Ort erfolgen. Sollte ein Termin erforderlich sein, bitte ich um entsprechende Vorschläge.
Bitte gewähren Sie mir die vollständige Belegeinsicht bis spätestens zum [konkretes Datum, z. B. 14 Tage später eintragen].
Bis zur vollständigen Prüfung der Abrechnung mache ich von meinem Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 BGB Gebrauch. Dies betrifft auch etwaige Mieterhöhungen aufgrund gestiegener Betriebskosten.
Ich bitte zudem um schriftliche Bestätigung des Eingangs dieses Schreibens. Sollte innerhalb der gesetzten Frist keine Reaktion erfolgen, behalte ich mir vor, rechtliche Schritte einzuleiten und den Mieterverein bzw. einen Rechtsanwalt mit der weiteren Vertretung meiner Interessen zu beauftragen.
Mit freundlichen Grüßen
(Unterschrift)
[Vor- und Nachname]
Hinweise zur Nutzung
- Anpassen: Ersetze die Beispielpositionen durch die tatsächlich beanstandeten Posten.
- Nachweise: Bewahre unbedingt einen Nachweis über den Versand auf (Einschreiben, Faxbericht, Empfangsbestätigung).
- Zeitnah verschicken: Auch wenn du 12 Monate Zeit hast – besser gleich reagieren, um Eskalationen (z. B. Mahnungen) zu vermeiden.
- Nicht zahlen: Wenn du nicht sicher bist, ob die Abrechnung korrekt ist, zahle vorerst nicht – oder nur unter Vorbehalt, falls du diesen Weg wählst (siehe Kapitel 7.2).
Zustellhinweis:
Am besten per Einschreiben mit Rückschein oder als persönliche Übergabe mit Empfangsbestätigung zustellen. WhatsApp, einfache E-Mail oder Einwurf in den Briefkasten reichen bei Streitigkeiten nicht als rechtssicherer Nachweis.
Tipp: Viele Mietervereine stellen ebenfalls Widerspruchsvorlagen zur Verfügung – oft angepasst an aktuelle Gerichtsurteile oder regionale Besonderheiten.
Das sagt die Rechtsprechung
Wenn es um Betriebskosten geht, ist längst nicht alles eine Frage der Auslegung – vieles ist bereits durch Gerichte entschieden worden. Und genau deshalb lohnt es sich, einen Blick auf die Rechtsprechung zu werfen: Sie gibt nicht nur Orientierung, sondern auch konkrete Anhaltspunkte, was zulässig ist – und was nicht.
Ob es um die Abrechnung von Sperrmüll, die Tätigkeit des Hausmeisters oder fragwürdige Versicherungspositionen geht: Viele Vermieter versuchen, Kosten abzurechnen, die nach Ansicht der Gerichte nicht umlagefähig sind. Wer die wichtigsten Urteile kennt, hat bei der Auseinandersetzung mit dem Vermieter also deutlich bessere Karten.
In diesem Kapitel findest du daher eine Auswahl relevanter Entscheidungen, die zeigen, wie Gerichte über gängige Streitfälle geurteilt haben – inklusive Aktenzeichen. Dabei geht es nicht um juristische Fachsimpelei, sondern um klare Beispiele aus der Praxis, die du als Argumentationshilfe im Widerspruch verwenden kannst.
Auswahl an relevanten Urteilen
Die Rechtsprechung rund um Betriebskosten ist reichhaltig – und sie wird regelmäßig erweitert. In den letzten Jahren haben Gerichte immer wieder deutlich gemacht, dass Mieter nicht jeden Betrag ungeprüft hinnehmen müssen. Im Folgenden findest du eine Auswahl besonders praxisrelevanter Urteile, die häufige Streitpunkte betreffen. Sie können als Orientierung und Argumentationshilfe im Widerspruch verwendet werden.
Unzulässige Umlage von Verwaltungskosten
Urteil: BGH, Urteil vom 20.01.2016 – VIII ZR 93/15
Kernaussage: Verwaltungskosten dürfen nicht auf die Mieter umgelegt werden – auch nicht anteilig oder unter anderem Namen.
Beispiel: Kosten für Buchhaltung, Mahnwesen, Schriftverkehr oder das Erstellen der Abrechnung müssen vom Vermieter selbst getragen werden.
Sperrmüll darf nicht einfach auf alle Mieter verteilt werden
Urteil: LG Düsseldorf, Urteil vom 02.03.2006 – 21 S 92/05
Kernaussage: Entsorgungskosten für illegal abgestellten Sperrmüll dürfen nur dann umgelegt werden, wenn der Verursacher nicht feststellbar ist und alle Mieter gleichermaßen betroffen sind.
Achtung: Ist der Verursacher bekannt, muss dieser allein die Kosten tragen – auch wenn er mittellos ist.
Hausmeisterkosten müssen klar aufgeschlüsselt sein
Urteil: BGH, Urteil vom 20.02.2008 – VIII ZR 27/07
Kernaussage: Die Tätigkeiten des Hausmeisters müssen nach Art und Umfang dargestellt werden.
Folge: Pauschale Angaben wie „Hauswartpauschale“ reichen nicht. Reparaturleistungen oder Verwaltungstätigkeiten dürfen nicht enthalten sein.
Kosten für Dachrinnenreinigung nur bei tatsächlicher Leistung
Urteil: LG Berlin, Urteil vom 14.09.2006 – 67 S 178/06
Kernaussage: Wenn eine angebliche Reinigung nicht nachvollziehbar ist (z. B. bei gleichbleibenden Kosten trotz Leerstand oder mangelnder Leistung), darf sie nicht abgerechnet werden.
Winterdienst bei dauerhaft schneefreier Lage? Nicht umlagefähig
Urteil: AG Köln, Urteil vom 14.01.2014 – 222 C 368/13
Kernaussage: Ein pauschaler Winterdienst ist nicht gerechtfertigt, wenn in einem Abrechnungsjahr nachweislich kein Wintereinbruch stattfand.
Beweislast: Der Mieter kann Wetterdaten und Zeugenaussagen vorlegen, um die Unverhältnismäßigkeit zu belegen.
Unklare Posten: „Sonstige Betriebskosten“ müssen konkret benannt sein
Urteil: BGH, Urteil vom 07.04.2004 – VIII ZR 167/03
Kernaussage: Allgemeine oder unklare Sammelposten (z. B. „Sonstiges“) dürfen nur dann abgerechnet werden, wenn deren Inhalt konkret benannt und im Mietvertrag vereinbart wurde.
Gebäudeversicherung darf keine Risikozuschläge enthalten
Urteil: LG Berlin, Urteil vom 15.04.2010 – 18 S 14/09
Kernaussage: Der Vermieter darf nur den marktüblichen Basisschutz auf die Betriebskosten umlegen. Risiko- oder Leerstandszuschläge sind nicht umlagefähig.
Kabel-TV seit 1. Juli 2024 nicht mehr über Betriebskosten
Gesetzlich geregelt: § 2 TKG (Telekommunikationsgesetz), Novelle 2021 – Übergangsfrist bis 30.06.2024
Folge: Seit dem 01.07.2024 dürfen Kabelgebühren nicht mehr über die Betriebskosten abgerechnet werden – unabhängig davon, ob der Mieter einen eigenen Vertrag abgeschlossen hat oder nicht.
Verweigerung der Belegeinsicht berechtigt zum Zurückbehaltungsrecht
Urteil: BGH, Urteil vom 08.03.2006 – VIII ZR 78/05
Kernaussage: Der Mieter darf eine Nachzahlung zurückbehalten, wenn ihm keine ausreichende Einsicht in die Abrechnungsbelege gewährt wird.
Diese Urteile zeigen: Nicht jede Abrechnung ist rechtens, und es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Wenn du deine Einwendungen mit konkreten Gerichtsurteilen untermauerst, erhöht das nicht nur den Druck auf den Vermieter – es zeigt auch, dass du deine Rechte kennst.
Zitate mit Aktenzeichen und Quelle
Gerichtsurteile sind nicht nur hilfreich für Fachleute – auch Mieter können sich darauf berufen, wenn sie eine Betriebskostenabrechnung anzweifeln. Wichtig ist, dass du bei einem Widerspruch möglichst konkret und nachvollziehbar argumentierst. Dazu eignen sich präzise Zitate aus der Rechtsprechung, inklusive Aktenzeichen und Gericht.
Im Folgenden findest du eine Auswahl juristisch relevanter Zitate, die sich direkt auf typische Streitpunkte bei Betriebskosten beziehen. Du kannst diese als Textbausteine in deinen Widerspruch einbauen oder zur Untermauerung deiner Position nutzen.
Verwaltungskosten nicht umlagefähig
„Verwaltungskosten gehören nicht zu den umlagefähigen Betriebskosten.“
BGH, Urteil vom 20. Januar 2016 – VIII ZR 93/15
Hausmeisterkosten müssen aufgeschlüsselt werden
„Werden Hauswartkosten abgerechnet, ist zu prüfen, ob darin auch Verwaltungstätigkeiten oder Reparaturen enthalten sind. Diese Anteile sind herauszurechnen.“
BGH, Urteil vom 20. Februar 2008 – VIII ZR 27/07
Belegeinsicht ist zwingend zu gewähren
„Der Mieter hat einen Anspruch auf Einsicht in die Abrechnungsunterlagen – ohne diese ist eine Nachforderung nicht fällig.“
BGH, Urteil vom 08. März 2006 – VIII ZR 78/05
Sonstige Betriebskosten nur mit konkreter Benennung
„Die Umlegung von sonstigen Betriebskosten setzt eine vorherige ausdrückliche Vereinbarung über die konkret benannten Kostenarten im Mietvertrag voraus.“
BGH, Urteil vom 07. April 2004 – VIII ZR 167/03
Gebäudeversicherung: Kein Risikozuschlag
„Der Vermieter darf bei der Gebäudeversicherung nur den üblichen Basisschutz abrechnen. Risiko- oder Leerstandszuschläge sind nicht umlagefähig.“
LG Berlin, Urteil vom 15. April 2010 – 18 S 14/09
Kabelgebühren nicht mehr umlagefähig
„Die Umlagefähigkeit der Kosten für den Kabelanschluss entfällt zum 30. Juni 2024. Ab dem 1. Juli 2024 müssen Mieter individuelle Verträge abschließen.“
Gesetzliche Grundlage: § 2 Abs. 2 Nr. 11 TKG (Telekommunikationsgesetz, n. F. 2021)
Sperrmüll durch Dritte ist kein Gemeinschaftskostenposten
„Kosten für die Entsorgung von Sperrmüll dürfen nur auf alle Mieter verteilt werden, wenn sich der Verursacher nicht feststellen lässt und eine generelle Betroffenheit vorliegt.“
LG Düsseldorf, Urteil vom 02. März 2006 – 21 S 92/05
Winterdienst muss notwendig und verhältnismäßig sein
„Die Umlage pauschaler Winterdienstkosten ist dann unwirksam, wenn im gesamten Abrechnungsjahr kein winterbedingter Einsatz erforderlich war.“
AG Köln, Urteil vom 14. Januar 2014 – 222 C 368/13
Dachrinnenreinigung nur bei nachweisbarer Durchführung
„Wiederkehrende Dachrinnenreinigungen müssen nachgewiesen und konkret belegt werden. Pauschale Abrechnungen ohne tatsächliche Leistung sind unzulässig.“
LG Berlin, Urteil vom 14. September 2006 – 67 S 178/06
Diese Zitate eignen sich besonders gut zur inhaltlichen Untermauerung deines Widerspruchs. Wenn du z. B. Einsicht in Originalbelege forderst, kannst du direkt auf das BGH-Urteil vom 08.03.2006 verweisen – das zeigt, dass du nicht nur „einfach meckerst“, sondern deine Forderung auf einem anerkannten Recht fußt.
👉 Tipp: Achte beim Zitieren darauf, den Kontext nicht zu verzerren. Ein Urteil kann sich z. B. auf einen sehr speziellen Einzelfall beziehen. Für den eigenen Widerspruch reicht es aber oft aus, das Grundprinzip des Urteils korrekt zu benennen.
Was du tun kannst, wenn der Vermieter nicht reagiert
Ein Widerspruch gegen die Betriebskostenabrechnung ist raus – doch dann herrscht Funkstille. Keine Eingangsbestätigung, keine Reaktion, keine Belegeinsicht. Leider kein Einzelfall. Viele Vermieter – ob große Wohnungsunternehmen oder private Eigentümer – reagieren auf Widersprüche entweder gar nicht oder erst, wenn es ihnen selbst unangenehm wird.
Das heißt aber nicht, dass du machtlos bist.
Denn wer als Mieter von seinem Recht auf Einsicht, Prüfung und Klärung Gebrauch macht, hat auch Möglichkeiten, sich gegen Ignoranz und Verzögerung zu wehren. Wichtig ist: ruhig bleiben, dokumentieren und gezielt handeln – mit klaren Fristen und rechtssicheren Schritten.
Dazu gehört auch die Art der Zustellung: Ein Widerspruch sollte nicht per E-Mail verschickt werden – außer du nutzt ein rechtssicheres Verfahren wie DE-Mail (was aber kaum jemand macht). Empfehlenswert ist daher der Versand per Einschreiben, idealerweise mit Rückschein. Damit hast du einen Einlieferungsbeleg und eine rechtlich verwertbare Bestätigung, dass dein Schreiben auch angekommen ist – falls der Vermieter später so tut, als hätte er nie etwas erhalten.
In diesem Kapitel erfährst du:
- welche Optionen dir zur Verfügung stehen,
- wie du dich absicherst,
- und ab wann professionelle Hilfe sinnvoll ist.
Denn eins ist klar: Wer sich nicht wehrt, zahlt drauf. Und das muss nicht sein.
Dokumentieren & Fristen setzen
Wenn der Vermieter oder die Hausverwaltung nach einem fristgerechten Widerspruch einfach nicht reagiert, solltest du das keinesfalls tatenlos hinnehmen. Stattdessen heißt es jetzt: kühlen Kopf bewahren, aber konsequent bleiben. Der wichtigste Schritt dabei ist eine saubere Dokumentation – und das Setzen verbindlicher Fristen. Denn nur so kannst du später belegen, dass du deine Rechte rechtzeitig und korrekt geltend gemacht hast.
1. Alles schriftlich – aber auch rechtssicher
Mündliche Aussagen, Anrufe oder beiläufige Gespräche mit dem Vermieter oder der Hausverwaltung haben vor Gericht so gut wie keinen Beweiswert. Deshalb gilt: Relevante Schreiben – vor allem Widersprüche, Fristsetzungen oder Aufforderungen zur Belegeinsicht – sollten immer schriftlich und nachweisbar erfolgen.
Die besten Möglichkeiten:
- Einschreiben mit Rückschein: Du erhältst eine Empfangsbestätigung mit Datum und Unterschrift.
- Einwurfeinschreiben: Etwas schwächer, aber immer noch besser als normaler Brief – der Einwurf wird dokumentiert.
- Persönliche Übergabe gegen Quittung: Du lässt dir den Erhalt des Schreibens auf einer Kopie bestätigen.
Nicht empfehlenswert:
- E-Mail: Auch mit Lesebestätigung oder Versandbeleg ist der rechtssichere Zugang nicht garantiert. Der Vermieter kann behaupten, die Mail nicht erhalten zu haben.
- WhatsApp, SMS oder Messenger: Gänzlich ungeeignet und vor Gericht nicht belastbar.
2. Fristsetzung: Klar, realistisch, dokumentiert
Wer nichts fordert, bekommt auch nichts – deshalb solltest du im Widerspruch oder spätestens bei der Anforderung von Belegen eine konkrete Frist setzen:
„Ich bitte um Einsicht in die vollständigen Abrechnungsunterlagen bis spätestens zum [Datum in 14 Tagen].“
Diese Frist muss:
- Kalendermäßig eindeutig sein (nicht „in zwei Wochen“, sondern: „bis zum 15. August 2025“),
- realistisch sein (mindestens 10–14 Tage ab Zugang),
- und schriftlich dokumentiert werden.
3. Beweise sammeln: Für den Fall der Fälle
Falls dein Anliegen ignoriert wird, solltest du den gesamten Schriftverkehr sorgfältig dokumentieren:
- Eingangsbestätigungen aufbewahren (z. B. Rückschein oder Empfangsquittung)
- Screenshots von E-Mails oder Sendungsverfolgungen sichern
- Antwortlose Zeiträume notieren
Wenn du später juristische Schritte einleiten oder dich an den Mieterverein wenden willst, sind das deine wichtigsten Belege.
4. Keine Rückmeldung? Dann Fristverlängerung mit Nachdruck
Wenn die gesetzte Frist abgelaufen ist und du nichts gehört hast, solltest du eine zweite Frist setzen – diesmal mit dem Hinweis, dass du rechtliche Schritte in Betracht ziehst, etwa so:
„Da Sie meine erste Frist unbeantwortet haben verstreichen lassen, setze ich Ihnen hiermit eine letzte Frist zur Beantwortung bis zum [neues Datum]. Sollte auch diese verstreichen, werde ich rechtliche Schritte prüfen und ggf. den Mieterverein oder eine anwaltliche Vertretung hinzuziehen.“
Vor- und Nachname
Straße und Hausnummer
PLZ Ort
An
[Name des Vermieters / der Hausverwaltung]
[Adresse des Vermieters / der Hausverwaltung]
Ort, Datum
Betreff: Fristsetzung zur Beantwortung meines Widerspruchs / zur Gewährung der Belegeinsicht
Sehr geehrte Damen und Herren,
am [Datum des Widerspruchs] habe ich fristgerecht Widerspruch gegen die Betriebskostenabrechnung für das Abrechnungsjahr [Jahr] eingelegt und dabei unter anderem Einsicht in die Abrechnungsunterlagen gefordert.
Bis heute ist keinerlei Reaktion Ihrerseits erfolgt. Ich weise Sie hiermit nochmals ausdrücklich darauf hin, dass mir gemäß § 259 BGB und § 556 BGB das Recht auf Belegeinsicht zusteht, und dass eine Nachzahlung ohne prüffähige Nachweise nicht geschuldet ist.
Ich setze Ihnen daher eine Frist bis zum [konkretes Datum, z. B. in 14 Tagen], um mir entweder
- Einsicht in die vollständigen Unterlagen zu gewähren oder
- mir begründet schriftlich mitzuteilen, warum dies nicht möglich sein soll.
Sollte diese Frist ohne Reaktion verstreichen, werde ich den Mieterverein bzw. einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung meiner Interessen beauftragen. Zudem behalte ich mir ausdrücklich vor, mein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 BGB weiter auszuüben.
Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieses Schreibens schriftlich.
Mit freundlichen Grüßen
(Unterschrift bei postalischem Versand)
[Vor- und Nachname]
Fazit
Die Kombination aus Fristsetzung und sauberer Dokumentation ist dein stärkstes Druckmittel. Nur so hast du in der Hand, was wann verlangt und ignoriert wurde – und bist rechtlich auf der sicheren Seite, wenn du später härtere Geschütze auffahren musst.
Unterstützung durch Mieterverein oder Anwalt
Nicht jeder Mieter möchte oder kann sich allein mit seinem Vermieter anlegen – besonders dann, wenn auf Schreiben keine Reaktion erfolgt oder die Abrechnung besonders komplex ist. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, sich professionelle Unterstützung zu holen.
Beitritt zum Mieterverein
Ein Mieterverein ist oft die erste Anlaufstelle für viele Betroffene. Die Mitgliedsbeiträge sind in der Regel moderat (ca. 80–120 € pro Jahr) und beinhalten eine umfassende rechtliche Beratung rund um das Mietverhältnis – einschließlich Betriebskosten, Mietminderung, Modernisierungen und vielem mehr.
Vorteile eines Mietervereins:
- Fachkundige Prüfung der Betriebskostenabrechnung
- Unterstützung bei der Formulierung von Widersprüchen
- Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber dem Vermieter
- Bereitstellung von Mustertexten und Merkblättern
- Teilweise auch anwaltliche Vertretung durch eigene Vertragsanwälte
Viele Vereine kooperieren mit spezialisierten Mietrechtskanzleien oder beschäftigen eigene Juristen, die dich bei Bedarf auch vor Gericht vertreten können – oft zu stark reduzierten Kosten oder sogar kostenlos im Rahmen der Mitgliedschaft.
Wenn der Gang zum Anwalt nötig wird
Reicht die Unterstützung des Mietervereins nicht aus – etwa weil bereits gerichtliche Schritte im Raum stehen oder eine Klage droht –, kann ein Fachanwalt für Mietrecht hinzugezogen werden. Zwar ist das in der Regel kostenpflichtig, aber in vielen Fällen übernimmt eine Rechtsschutzversicherung die Kosten. Alternativ kann bei geringem Einkommen auch Beratungshilfe beim Amtsgericht beantragt werden.
Ein Anwalt kann:
- Akteneinsicht auch gerichtlich durchsetzen
- Vermieter zur Abrechnung oder Erstattung zwingen
- Fristen verbindlich setzen und einklagen
- Vertretung übernehmen, z. B. bei Klage wegen unberechtigter Nachforderungen
Fazit
Ob Mieterverein oder Anwalt – du musst nicht alles allein durchkämpfen. Wer sachlich bleibt, gut dokumentiert und sich im Zweifel Hilfe holt, hat vor Gericht oder gegenüber großen Wohnungsunternehmen oft die besseren Karten.
Zahlung unter Vorbehalt oder Einbehalt
Wenn du einer Betriebskostenabrechnung nicht zustimmst, aber der Vermieter auf Zahlung besteht, stellt sich oft die Frage: Zahlen oder nicht? In solchen Fällen hört man häufig den Vorschlag, die geforderte Summe zunächst „unter Vorbehalt“ zu bezahlen. Doch Vorsicht: Das klingt einfacher, als es in der Praxis oft ist.
Zahlung unter Vorbehalt: Was bedeutet das?
Bei einer Zahlung unter Vorbehalt erklärst du ausdrücklich, dass du nur deshalb zahlst, um mögliche rechtliche Nachteile (z. B. Mahnbescheide oder Kündigungen) zu vermeiden – nicht, weil du die Abrechnung für korrekt hältst. Du hältst dir damit rechtlich die Möglichkeit offen, das Geld später zurückzufordern, sollte sich herausstellen, dass bestimmte Positionen unrechtmäßig waren.
Damit das rechtlich Bestand hat, solltest du:
- Die Zahlung schriftlich mit einem klaren Vorbehalt versehen, z. B.: „Die Zahlung erfolgt ausschließlich unter dem Vorbehalt der rechtlichen Klärung. Ich behalte mir ausdrücklich eine Rückforderung vor.“
- Die Erklärung zeitgleich oder unmittelbar vor der Zahlung abgeben – idealerweise in Textform per Einschreiben
- Den Zahlungsvorgang und die Erklärung dokumentieren
Warum das nicht immer empfehlenswert ist
Auch wenn es sich rechtlich gut anhört – die Praxis zeigt: Hat der Vermieter das Geld erst einmal, bekommst du es nur schwer wieder zurück.
Denn:
- Viele Vermieter reagieren nicht auf Rückforderungsansprüche, selbst wenn Belege falsch oder unvollständig sind.
- Ohne rechtlichen Druck (z. B. Anwalt oder Gericht) bleibt eine Rückzahlung meist aus.
- Du musst selbst tätig werden und nachweisen, dass die Abrechnung fehlerhaft war.
- Der Weg kann sich über Monate oder sogar Jahre hinziehen – inklusive Schriftverkehr, Fristen und ggf. Klage.
In vielen Fällen ist die Verweigerung der Zahlung mit klar formuliertem Widerspruch und Zurückbehaltungsrecht (§ 273 BGB) der bessere Weg – so lange die Abrechnung nicht belegt oder begründet ist. Das gibt dir mehr Druckmittel in der Hand.
Alternative: Zahlungseinbehalt mit Verweis auf Belegeinsicht
Wenn du ernsthafte Zweifel an der Abrechnung hast, aber auf Nummer sicher gehen willst, kannst du die Zahlung auch zurückhalten mit Hinweis auf dein Zurückbehaltungsrecht:
„Bis zur vollständigen Belegprüfung mache ich von meinem Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 BGB Gebrauch. Eine Zahlung erfolgt erst nach Einsicht und Klärung der strittigen Posten.“
Diese Variante ist oft wirksamer – insbesondere, wenn du dem Vermieter gleichzeitig eine Frist zur Belegübersendung oder Einsicht setzt und den Widerspruch dokumentierst (am besten per Einschreiben).
Fazit
Zahlung unter Vorbehalt kann rechtlich funktionieren – ist aber in der Praxis riskant. Viele Mieter sehen das Geld nie wieder oder müssen es mühsam einklagen. Besser ist es oft, gar nicht erst zu zahlen, solange offene Fragen bestehen. Nutze dein Recht auf Belegeinsicht, wähle klare Worte im Widerspruch – und lass dich ggf. durch einen Mieterverein oder Anwalt unterstützen.
Fazit: Kritisch bleiben lohnt sich
Eine Betriebskostenabrechnung ist kein unanfechtbares Urteil – auch wenn sie oft so wirkt. Vielmehr ist sie ein komplexes Zahlenwerk, das auf gesetzlichen Vorgaben, vertraglichen Regelungen und tatsächlichen Gegebenheiten beruhen muss. Genau deshalb lohnt es sich, jede einzelne Position mit wachem Blick zu prüfen – gerade dann, wenn einem Posten unplausibel, überhöht oder schlichtweg unberechtigt erscheinen.
Immer wieder zeigt sich: Wer nachfragt, Belege anfordert und Widerspruch einlegt, stößt auf Fehler, unzulässige Kosten oder schlichtweg intransparente Abrechnungen. Und genau hier liegt die Chance. Denn Betriebskosten sind keine freiwillige Spende an den Vermieter – sie müssen korrekt, nachvollziehbar und im Rahmen der rechtlichen Vorgaben abgerechnet werden.
Natürlich ist es bequem, die Abrechnung einfach abzunicken – doch diese Bequemlichkeit kann teuer werden. Wer sich informiert, Fristen einhält und notfalls auf sein Zurückbehaltungsrecht pocht, steht rechtlich meist besser da als gedacht. Und: Man ist damit nicht allein. Ob mit Unterstützung eines Mietervereins, eines Anwalts oder durch Urteile der Gerichte – Mieterrechte sind keine Worthülse, sondern durchsetzbar.
Also: Nicht einschüchtern lassen, nicht alles glauben – und schon gar nicht einfach zahlen. Kritisch bleiben lohnt sich. Immer.
Hinweis in eigener Sache
Dieser Artikel wurde mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und auf Basis der aktuellen Rechtslage verfasst. Er dient der allgemeinen Information, will sensibilisieren, Orientierung geben und dazu ermutigen, Betriebskostenabrechnungen kritisch zu hinterfragen. Dabei basiert er auf gesetzlichen Regelungen, gängigen Urteilen und typischen Streitpunkten aus der Praxis.
Aber wichtig: Es handelt sich nicht um eine Rechtsberatung. Jeder Mietvertrag kann anders gestaltet sein, jede Abrechnung Besonderheiten enthalten – und ob eine bestimmte Kostenposition im Einzelfall zulässig ist, kann letztlich nur von einem Rechtsanwalt oder einem Gericht beurteilt werden.
Wenn du konkrete Fragen zu deiner Abrechnung hast oder sich der Vermieter trotz Widerspruch nicht rührt, solltest du dich an einen Mieterverein oder einen spezialisierten Anwalt wenden. Diese können deine individuelle Situation prüfen und rechtssicher beraten.
Alle Angaben in diesem Beitrag erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Fehler sind trotz größter Sorgfalt nicht ausgeschlossen – und Gesetze sowie Rechtsprechung können sich ändern. Dieser Artikel erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder juristische Verbindlichkeit.
Gesetzliche Grundlagen im Überblick
Damit du die wichtigsten Rechtsgrundlagen bei Bedarf selbst nachlesen kannst, findest du hier die offiziellen Links zu den genannten Paragraphen:
§ 2 BetrKV – Betriebskostenarten
(Welche Kostenarten grundsätzlich umlagefähig sind)
§ 556 BGB – Vereinbarungen über Betriebskosten
(Regelt, wann und wie Betriebskosten abgerechnet werden dürfen)
§ 273 BGB – Zurückbehaltungsrecht
(Ermöglicht das Zurückhalten von Zahlungen bei offenen Forderungen)
Diese Links führen dich direkt zur offiziellen Seite des Bundesministeriums der Justiz (gesetze-im-internet.de).
Danke fürs Lesen!
Wenn dir dieser Artikel geholfen hat oder du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, teile ihn gerne – ganz unten findest du die entsprechenden Social-Media-Buttons. Vielleicht hilft er ja auch anderen dabei, ihre Abrechnung genauer unter die Lupe zu nehmen.
Hast du Fragen, Anmerkungen oder möchtest deine eigene Geschichte loswerden? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion unter dem Beitrag – Austausch ist ausdrücklich erwünscht.
Und wenn du auf dem Laufenden bleiben willst: Folge mir auf Facebook unter facebook.aufgedeckt24.de. Dort findest du regelmäßig neue Beiträge, Updates zu laufenden Fällen und alles, was sonst noch so schiefläuft in Ämtern, Unternehmen & Co.
Bleib wachsam – und kritisch.
Denn blind vertrauen ist genau das, was sich viele wünschen. Und genau das, was man vermeiden sollte.