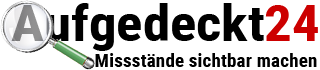Eigentlich erwartet man von Behörden, dass sie sorgsam mit den Daten der Bürger umgehen. Doch manchmal landet plötzlich ein Brief im Kasten, der eine ganz andere Realität zeigt. Genau das ist mir passiert: Ein Schreiben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) – verbunden mit der Aufforderung, an einer „wissenschaftlichen Befragung“ teilzunehmen.
Das Problem daran: Ich habe nie zugestimmt, dass meine Adresse für solche Zwecke genutzt wird. Und trotzdem lag nicht nur ein Brief im Kasten – sondern kurze Zeit später auch noch ein zweiter.
Was zunächst harmlos klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein bemerkenswerter Einblick in den Umgang deutscher Behörden mit personenbezogenen Daten. Hinter freundlichen Formulierungen wie „freiwillig“ und „anonym“ steckt ein System, das auf gesetzliche Lücken setzt, auf Technik vertraut – und auf das Schweigen der Betroffenen hofft.
In diesem Artikel zeige ich Schritt für Schritt, wie diese Befragung ablief, warum sie datenschutzrechtlich mehr als fragwürdig ist, und weshalb solche Fälle nicht unter den Teppich gehören. Denn wenn Behörden wissenschaftliche Zwecke nutzen, um ohne Einwilligung Bürger anzuschreiben, dann ist es höchste Zeit, genauer hinzuschauen.
Ein Brief vom IAB – und die erste Verwunderung
Manchmal liegt in der Post etwas, das man auf den ersten Blick gar nicht richtig einordnen kann.
So ging es mir, als ich einen Brief vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung – kurz IAB – im Briefkasten fand. Absender: Bundesagentur für Arbeit, Thema: „Wissenschaftliche Studie zu Arbeit und Einkommen“.
Klingt harmlos, fast schon höflich. Nur: Ich habe mit der Bundesagentur für Arbeit gar nichts zu tun.
Ich beziehe Bürgergeld, und dafür ist bei uns in Aurich das Jobcenter zuständig, nicht die Arbeitsagentur. Trotzdem hat das IAB offenbar meine Adresse – und lud mich „freundlich“ zu einer Online-Befragung ein, samt persönlichem Zugangscode.
Schon nach den ersten Zeilen fragte ich mich:
Wie kommt diese Behörde überhaupt an meine Daten? Und warum werde ich für etwas „wissenschaftlich Zufälliges“ ausgewählt, das sich für mich ziemlich gezielt anfühlt?
Wie alles anfing: Ein Schreiben vom „Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung“
Los ging’s mit einem Brief, der auf den ersten Blick amtlich-seriös wirkte: Logo des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Absenderadresse in Nürnberg, Betreff: „Wissenschaftliche Studie zu Ihren Ansichten zum Thema ‚Arbeit und Einkommen‘“. Im Text stand, man sei „unabhängig von meiner aktuellen Situation und meinem Einkommen“ an meinen persönlichen Ansichten interessiert. Die Befragung solle nur zehn Minuten dauern, Teilnahme freiwillig, alles streng vertraulich und anonym – so die Versprechen.
Praktisch vorbereitet war das Ganze auch: QR-Code, eine kurze Webadresse zur Befragung und ein individueller Zugangscode (den ich hier unkenntlich lasse). Dazu eine Kontaktadresse (arbeit-einkommen@iab.de)
) und die Unterschriften des IAB-Direktors und des Studienleiters. Auf der Rückseite folgte die komplette Datenschutzerklärung mit Verweisen auf DSGVO und – besonders wichtig – § 282 Abs. 5 SGB III. Dort steht sinngemäß, dass das IAB für wissenschaftliche Zwecke Personen anschreiben darf, wenn sich die benötigten Informationen nicht aus vorhandenen Daten ableiten lassen. Und genau an dieser Stelle wurde es für mich interessant.
Denn während der Ton im Schreiben freundlich und die Teilnahme „freiwillig“ war, blieb eine Frage sofort im Raum stehen: Warum bekomme ich Post von der Bundesagentur-Tochter IAB, wenn für mich in Aurich das Jobcenter zuständig ist – und nicht die Arbeitsagentur? Im Brief stand die Antwort gleich mit drin: Meine Kontaktdaten habe das IAB von der Bundesagentur für Arbeit erhalten. Aus „Zufallsauswahl“ wurde für mich in dem Moment ein sehr konkreter Zugriff auf meine Adresse. Genau das war der Startpunkt meiner Verwunderung – und der Anlass, genauer hinzuschauen, was hinter dieser angeblich so harmlosen „wissenschaftlichen Einladung“ tatsächlich steckt.
Die angebliche wissenschaftliche Befragung zu „Arbeit und Einkommen“
Im Mittelpunkt des Schreibens stand eine Online-Befragung mit dem Titel „Arbeit und Einkommen“.
Sie wurde in schönster Behördensprache als „wissenschaftliche Studie“ beschrieben – mit dem Ziel, die Politik „bei Entscheidungen zu unterstützen“. Klingt auf den ersten Blick edel, nach Forschung im Dienste des Gemeinwohls. Nur leider bleibt der Text dabei so vage, dass man als Empfänger kaum erfährt, worum es inhaltlich überhaupt geht.
Es hieß, man wolle erfahren, „wie Menschen Arbeitsmarktsituationen einschätzen“. Keine Beispiele, keine Themenvorschau, keine konkreten Fragen. Nur die Behauptung, dass es sich um eine wichtige wissenschaftliche Erhebung handle.
Dazu der Hinweis, dass die Befragung „unabhängig von meiner aktuellen Situation und meinem Einkommen“ sei – was schon fast ironisch klingt, wenn die Daten gleichzeitig von der Bundesagentur für Arbeit stammen.
Ich soll also an einer Studie teilnehmen, deren Inhalt ich nicht kenne, die von einer Behörde kommt, die für mich eigentlich gar nicht zuständig ist, und deren Datenschutzlogik sich offenbar nach der Überschrift „wissenschaftlich“ richtet.
Das Ganze wirkt wie ein Forschungsauftrag mit amtlichem Siegel, bei dem die entscheidenden Details – Zweck, Inhalte, Auswertungsmethoden – bewusst im Nebel bleiben.
Die Aufmachung erinnerte dabei stark an amtliche Schreiben: sachlich, distanziert, mit Siegelcharakter. Wer nicht genau hinsieht, könnte glatt annehmen, es handele sich um eine offizielle Pflichtbefragung. Zwar steht im Text das Wort „freiwillig“, aber gleich daneben findet sich der moralische Druck, man solle doch bitte teilnehmen, „um politische Entscheidungen zu unterstützen“.
Mit anderen Worten: Freiwillig – aber mit schlechtem Gewissen, wenn man es nicht tut.
Auch die Formulierung, man sei „durch ein statistisches Zufallsverfahren“ ausgewählt worden, klang eher nach einem beschönigenden Euphemismus. Denn ein echter Zufall liegt kaum vor, wenn eine Bundesbehörde gezielt Datensätze durchsucht und einzelne Adressen herausfiltert.
Ein Zufall ist das nur für den Empfänger – nicht für die Behörde, die den Brief verschickt.
Je länger ich das Schreiben las, desto stärker drängte sich mir der Eindruck auf, dass hier nicht Wissenschaft, sondern Verwaltung mit Forschungsdeckmantel am Werk war.
Wissenschaft lebt von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Freiwilligkeit – hier dagegen wurde mir ein persönlicher Zugangscode zugeteilt, über den ich bis zum 31. Dezember 2025 an der Befragung teilnehmen könne.
Allein die Tatsache, dass dieser Zeitraum über mehrere Wochen offen bleibt, zeigt, wie standardisiert und massenhaft solche Einladungen verschickt werden.
Was also als harmloses Forschungsprojekt verkauft wird, wirkt bei näherem Hinsehen wie ein systematischer Datenabruf mit freundlichem Anstrich.
Eine „wissenschaftliche Befragung“, deren Absender direkt auf die Datenbank der Bundesagentur zugreifen kann – und sich dabei auf ein Gesetz beruft, das kaum jemand kennt.
Erste Zweifel: Warum ich überhaupt angeschrieben werde
Der erste Stolperstein kam sofort: Warum schreibt mich ausgerechnet das IAB an, wenn für mich das Jobcenter zuständig ist – und nicht die Arbeitsagentur?
Ich bekomme Bürgergeld. Mein Ansprechpartner sitzt im Jobcenter. Wenn ich mit der Bundesagentur für Arbeit zu tun habe, dann höchstens indirekt über Formulare, die irgendwo zentral „mitgeführt“ werden. Ein Brief direkt von deren Forschungseinrichtung? Das passt nicht ins Bild.
Im Schreiben stand die Begründung schon drin: Das IAB habe meine Kontaktdaten von der Bundesagentur für Arbeit erhalten, „um diese wissenschaftliche Befragung durchzuführen“. An dieser Stelle gehen bei mir alle Antennen hoch.
Denn „wissenschaftlich“ ist das Zauberwort, hinter dem sich plötzlich vieles verbirgt: Adressnutzung ohne Einwilligung, „Zufallsauswahl“ aus Datenbanken, standardisierte Massenanschreiben – und am Ende der freundliche Hinweis, man möge doch bitte teilnehmen, „um politische Entscheidungen zu unterstützen“. Schön verpackt, aber inhaltlich bleibt eine eindeutige Asymmetrie: Sie greifen zu – ich soll liefern.
Dann die viel zitierte „Zufallsauswahl“. Klingt nett, aber was heißt das konkret?
Irgendwo sitzt eine Behörde auf einem umfangreichen Datenbestand. Daraus werden Adressen herausgefiltert, personalisierte Zugangscodes erzeugt und Briefe produziert. Zufällig ist daran vor allem, wen es trifft – nicht, dass es passiert. Für mich fühlt sich das nicht wie ein wissenschaftlicher Zufall an, sondern wie ein sehr geplanter Verwaltungsprozess, der mit Forschungsschminke übertüncht ist.
Was meine Zweifel endgültig befeuert hat, war der zweite Brief – die „Erinnerung“. Ich hatte auf die erste Einladung bewusst nicht reagiert. Aus meiner Sicht ist damit alles gesagt: kein Interesse.
Wenn danach ein Nachfass-Schreiben kommt, kippt die freundliche Einladung in Richtung Beharrlichkeit. Spätestens hier stellt sich die Frage: Wo endet eine zulässige Kontaktaufnahme – und wo beginnt Belästigung? Wenn Freiwilligkeit ernst gemeint ist, akzeptiert man auch ein klares Schweigen.
Zusammengefasst:
- Ich werde von einer nicht zuständigen Stelle angeschrieben – mit dem Hinweis, meine Adresse stamme von dort.
- Ich soll an einer inhaltlich vagen Studie teilnehmen, deren Zweck und Fragen im Dunkeln bleiben.
- Die „Zufallsauswahl“ fühlt sich nach Datenzugriff mit Serienbrieffunktion an.
- Auf keine Reaktion folgt eine Erinnerung – also ein zweiter Kontakt, der das Wort „freiwillig“ ziemlich ausleiert.
Genau an diesem Punkt entstanden meine grundsätzlichen Zweifel:
Nicht, weil Forschung per se schlecht wäre – sondern weil hier Macht über Daten und fehlender Respekt vor Privatsphäre zusammenkommen. Wenn man Menschen wirklich gewinnen will, braucht es Transparenz, Zurückhaltung und Wahlfreiheit. Stattdessen bekam ich zwei Briefe und viele hübsche Wörter.
Wer ist das IAB überhaupt?
Bevor man überhaupt versteht, warum dieses Schreiben so irritierend wirkt, muss man wissen, wer oder was das IAB eigentlich ist.
Denn das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung klingt zunächst wie eine neutrale wissenschaftliche Einrichtung – vielleicht so etwas wie ein unabhängiges Forschungsinstitut oder eine Uni-Abteilung.
In Wirklichkeit ist das IAB aber die hauseigene Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit.
Es sitzt im gleichen Gebäudekomplex in Nürnberg, nutzt die Datenbestände der BA und wird auch von ihr finanziert. Nur organisatorisch ist es – so betont man gerne – „unabhängig“.
Das heißt übersetzt: Es gehört zur Bundesagentur, arbeitet aber angeblich eigenständig, um die „Wissenschafts- und Forschungsfreiheit“ zu wahren.
Auf dem Papier klingt das nach einer sauberen Trennung. In der Praxis bedeutet es:
Das IAB forscht mit Daten, die direkt aus dem System der Bundesagentur stammen – also aus Beschäftigungs- und Leistungsdaten, die Millionen von Menschen betreffen.
Und genau hier wird es spannend: Diese Doppelrolle – Teil der Behörde, aber zugleich „wissenschaftlich unabhängig“ – ist der Grund, warum das IAB überhaupt solche Briefe verschicken darf.
Um zu verstehen, wie das rechtlich funktioniert, lohnt sich ein genauer Blick darauf, welche Aufgaben das IAB offiziell hat und wo seine Grenzen eigentlich liegen sollten.
Offizielle Rolle des Instituts
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird nach außen als wissenschaftliche Einrichtung präsentiert – und das ist es formal gesehen auch. Es ist keine Universität, kein privates Forschungszentrum und auch keine klassische Behörde.
Vielmehr handelt es sich um eine Sonderabteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA), die den Auftrag hat, den deutschen Arbeitsmarkt zu erforschen, Trends zu erkennen und politische Entscheidungsträger zu beraten.
Konkret bedeutet das: Das IAB soll herausfinden, wie sich Beschäftigung, Einkommen, Weiterbildung, Arbeitslosigkeit oder auch Bildungswege in Deutschland entwickeln. Dafür nutzt es Daten, die ohnehin in der Bundesagentur gespeichert sind – etwa Meldungen von Arbeitgebern, Arbeitslosenzahlen oder Qualifikationsstatistiken.
Ziel ist es laut eigener Darstellung, „wissenschaftliche Grundlagen für die Arbeitsmarktpolitik“ zu liefern. Das klingt zunächst vernünftig – schließlich braucht Politik verlässliche Daten, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen.
Das IAB veröffentlicht regelmäßig Studien, Forschungsberichte und Analysen, die oft in Medien oder Regierungsdokumenten zitiert werden. Von außen betrachtet wirkt das Institut wie ein neutraler Beobachter, der auf Fakten basiert. In der Realität ist das IAB aber nicht unabhängig im klassischen Sinn, sondern eng an die Strukturen der Bundesagentur gebunden.
Zwar betont man immer wieder, das Institut sei „räumlich, personell und organisatorisch getrennt“, um die Wissenschaftsfreiheit zu sichern.
Aber diese Trennung existiert innerhalb desselben Apparats – die BA stellt Personal, zahlt Gehälter, liefert Daten und definiert Themenfelder.
Das IAB kann also kaum völlig losgelöst agieren. Es forscht nicht „über“ die Bundesagentur, sondern für sie.
Genau diese Struktur verschafft dem Institut Zugriff auf gewaltige Datenmengen, die sonst kaum ein anderer Forschungsakteur in Deutschland bekommt. Während unabhängige Wissenschaftler monatelang auf Genehmigungen für anonymisierte Daten warten, kann das IAB direkt auf die internen Systeme der BA zugreifen – zumindest in Teilen und unter bestimmten rechtlichen Auflagen.
Und genau an dieser Stelle kommt die Brücke zu meinem Brief:
Weil das IAB zur Bundesagentur gehört, darf es nach § 282 Abs. 5 SGB III personenbezogene Daten aus den BA-Beständen verwenden, um Bürger zu kontaktieren und an Befragungen teilzunehmen.
Das ist kein Datenleck, sondern gesetzlich erlaubt – allerdings unter der Bedingung, dass es sich um Forschung handelt, nicht um Verwaltung oder Werbung.
Mit dieser Sonderrolle hat sich das Institut eine komfortable Position geschaffen:
Es kann gleichzeitig sagen, es sei wissenschaftlich unabhängig, aber trotzdem behördlich legitimiert.
Ein Spagat, der auf dem Papier funktioniert – in der Praxis aber den Datenschutz auf sehr dünnem Eis balancieren lässt.
Verbindung zur Bundesagentur für Arbeit
Um zu verstehen, wie das IAB an meine Adresse gekommen ist, muss man sich seine enge Verflechtung mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) ansehen.
Denn das Institut ist kein externer Forschungsdienstleister, sondern eine Einrichtung innerhalb der Bundesagentur – organisatorisch angegliedert, aber formal als Forschungsabteilung mit eigenem Namen ausgestattet.
Die Zentrale der Bundesagentur sitzt in Nürnberg, genau wie das IAB. Beide teilen sich teilweise dieselben Gebäude, dieselben IT-Strukturen und vor allem: denselben Datenpool.
Das IAB forscht also mit Daten, die von der BA erhoben und gespeichert werden – beispielsweise Beschäftigungszeiten, Sozialversicherungsdaten, Weiterbildungsteilnahmen oder Angaben aus Leistungsakten.
All das sind Daten, die Bürgerinnen und Bürger im Laufe ihrer Arbeitsbiografie zwangsläufig hinterlassen, wenn sie angestellt, arbeitslos, arbeitssuchend oder in Maßnahmen eingebunden sind.
Normalerweise sind diese Daten streng geschützt. Kein Wissenschaftler dürfte sie einfach so einsehen oder nutzen, ohne eine rechtliche Grundlage und eine klare Anonymisierung.
Doch genau hier greift die Sonderstellung des IAB:
Da es Teil der Bundesagentur für Arbeit ist, darf es auf bestimmte Daten direkt zugreifen, solange diese Nutzung durch den gesetzlichen Auftrag zur Forschung gedeckt ist.
Diese Verbindung ist auch der Grund, warum das IAB im Brief schreiben kann:
„Das IAB hat Ihre Kontaktdaten von der Bundesagentur für Arbeit erhalten.“
Das ist kein Datenleck und kein Fehler, sondern Absicht und Routine.
Denn die Bundesagentur darf laut § 282 Abs. 5 SGB III ihre eigenen Forschungsabteilungen mit personenbezogenen Daten versorgen, um wissenschaftliche Befragungen durchzuführen.
Offiziell heißt das „gesetzlich erlaubte Datenübermittlung im Rahmen des Forschungsauftrags“. In der Praxis bedeutet es: Die Behörde darf Bürger direkt anschreiben, auch wenn diese nie zugestimmt haben.
Zwar betont man, dass das IAB „räumlich, personell und organisatorisch getrennt“ von der BA sei – ein beliebter Satz in beiden Schreiben –, doch das ist eher eine formale Schutzbehauptung als eine echte Trennung.
Die Forscher des IAB sitzen nicht zufällig im selben Gebäudekomplex wie die BA, sie arbeiten mit deren Infrastruktur, nutzen deren E-Mail-Systeme und lassen sich ihre Projekte von ihr genehmigen und finanzieren.
Kurz gesagt:
Die Bundesagentur für Arbeit ist der Kopf, das IAB der Forschungssarm derselben Behörde.
Und weil beide unter demselben Dach agieren, gelten besondere Datenschutzregeln, die sonst niemandem zustehen.
Was in der Theorie nach effizienter Zusammenarbeit klingt, ist in der Praxis ein Datenmonopol, das keine zweite Einrichtung in Deutschland hat.
Während Universitäten monatelang auf Zugänge zu anonymisierten Datensätzen warten, kann das IAB im Auftrag der BA gezielt Menschen anschreiben – mit dem Stempel der Wissenschaft, aber den Mitteln der Verwaltung.
Und genau diese Verbindung macht die ganze Angelegenheit so heikel: Sie erlaubt etwas, das im normalen Datenschutzverständnis undenkbar wäre.
Was sie dürfen – und was eigentlich nicht
Genau hier beginnt der rechtliche Spagat zwischen wissenschaftlicher Freiheit und Datenschutzgrenzen.
Das IAB darf vieles – aber längst nicht alles. Und der Unterschied zwischen „erlaubt“ und „eigentlich nicht vorgesehen“ ist im Gesetz oft nur ein paar Zeilen lang.
Die Grundlage für das Handeln des IAB ist, wie mehrfach erwähnt, § 282 Absatz 5 des Sozialgesetzbuches III (SGB III).
Dort steht, stark vereinfacht:
Die Bundesagentur für Arbeit darf ihre Daten zu wissenschaftlichen Zwecken nutzen und Personen anschreiben, wenn bestimmte Informationen auf anderem Wege nicht gewonnen werden können.
Das bedeutet:
- Das IAB darf personenbezogene Daten (wie Name und Anschrift) verwenden, um eine Einladung zu versenden.
- Die Teilnahme an der Befragung muss freiwillig sein.
- Die erhobenen Antworten müssen anonymisiert werden, bevor sie ausgewertet werden.
- Eine weitere Verwendung der Daten, etwa für Verwaltungszwecke, Werbung oder Leistungsentscheidungen, ist ausdrücklich verboten.
So weit, so klar.
Aber das Gesetz sagt eben nur, dass sie einmal anschreiben dürfen – und dass die Teilnahme freiwillig ist.
Von Erinnerungen, Nachfassaktionen oder gar wiederholten Kontaktaufnahmen steht dort kein Wort.
Genau das macht den zweiten Brief so fragwürdig: Er bewegt sich in einer Grauzone, für die es keine ausdrückliche Erlaubnis gibt.
Das IAB rechtfertigt solche Erinnerungen meist damit, dass sie „die Repräsentativität der Studie sichern“ wollen – also sicherstellen, dass nicht nur bestimmte Gruppen antworten.
Das mag wissenschaftlich nachvollziehbar sein, ändert aber nichts daran, dass der zweite Brief datenschutzrechtlich auf sehr dünnem Eis steht.
Denn mit der ersten Einladung wurde der gesetzliche Zweck – die Kontaktaufnahme – bereits erfüllt.
Alles, was danach kommt, ist Interpretationssache.
Ebenfalls problematisch: Die Formulierung im Brief, man sei „unabhängig von der aktuellen Situation und dem Einkommen“ an meinen Ansichten interessiert.
Das klingt neutral, ist es aber nicht.
Wenn die Daten aus dem System der Bundesagentur stammen, weiß das IAB bereits, wer im Bürgergeldbezug, in Weiterbildung oder im Arbeitsverhältnis steht.
Von völliger Unabhängigkeit kann also keine Rede sein – die Auswahl erfolgt nicht im luftleeren Raum, sondern auf Basis vorhandener Verwaltungsdaten.
Ein weiterer Punkt:
Das IAB darf Daten nur dann mit bestehenden Beständen zusammenführen, wenn die betroffene Person ausdrücklich einwilligt.
Im Klartext heißt das: Selbst wenn ich an der Befragung teilgenommen hätte, dürften meine Antworten nicht automatisch mit meinen gespeicherten Leistungsdaten verknüpft werden – es sei denn, ich stimme dem ausdrücklich zu.
Doch genau diese Formulierung („Wir dürfen nur, wenn Sie einwilligen“) steht auf der Rückseite des Schreibens ganz unten, wo sie kaum jemand liest.
Zusammengefasst heißt das:
- Das IAB darf dich einmalig anschreiben – ja.
- Es darf anonymisierte Antworten auswerten – ja.
- Es darf mehrfachen Briefe schicken, wenn du nicht reagierst – eigentlich nein.
- Es darf Datenverknüpfungen ohne Einwilligung vornehmen – ausdrücklich nein.
- Und es darf Konsequenzen ziehen, wenn du nicht teilnimmst – ohnehin nicht.
In der Praxis aber verschwimmen diese Grenzen.
Was als „wissenschaftliche Erhebung“ beginnt, endet schnell in einer halbamtlichen Nachfassaktion, die eher an Verwaltung erinnert als an Forschung.
Und genau das macht das Verhalten des IAB so problematisch:
Sie bewegen sich auf einem rechtlich erlaubten, aber moralisch fragwürdigen Terrain – geschützt durch ein Gesetz, das längst reformbedürftig ist.
Woher haben die meine Adresse?
Diese Frage drängt sich geradezu auf – und sie ist der Kern des ganzen Problems.
Denn wer Post von einer Behörde bekommt, möchte wissen, woher die überhaupt an die eigenen Daten gekommen ist.
Im Fall des IAB war die Antwort bereits im Schreiben versteckt:
„Das IAB hat Ihre Kontaktdaten von der Bundesagentur für Arbeit erhalten.“
Klingt harmlos, ist aber ein Satz mit Sprengkraft.
Denn ich habe der Bundesagentur niemals erlaubt, meine Daten für Umfragen oder Studien weiterzugeben.
Und schon gar nicht an ein Institut, das sich zwar „wissenschaftlich unabhängig“ nennt, aber zur selben Behörde gehört.
Genau hier zeigt sich, wie weitreichend die Datensammelbefugnisse der Bundesagentur für Arbeit tatsächlich sind – und wie leicht sie diese Informationen intern weiterreichen kann.
Ob jemand Arbeitslosengeld, Bürgergeld oder gar keine Leistung bezieht, spielt offenbar keine Rolle.
Wer einmal im System der Bundesagentur landet – etwa durch frühere Beschäftigungsmeldungen, Bewerberregistrierungen oder Leistungsbezug –, der kann später als „Zufallsauswahl“ in einer sogenannten wissenschaftlichen Studie auftauchen.
Was in der Theorie nach Statistik klingt, wirkt in der Praxis wie ein staatlicher Adresspool, auf den verschiedenste Stellen zugreifen dürfen.
Und das, ohne dass Betroffene jemals informiert oder gefragt wurden.
Der entscheidende Satz im Brief
Alles steht und fällt mit einer einzigen Zeile, die im Fließtext fast untergeht – aber juristisch die Tür öffnet:
„Das IAB hat Ihre Kontaktdaten von der Bundesagentur für Arbeit erhalten.“
Genau dieser Satz erklärt, warum du den Brief überhaupt bekommen hast – ohne jemals eingewilligt zu haben. Er verrät drei Dinge:
- Datenquelle: Deine Anschrift stammt nicht aus einem Adresskauf, nicht aus einem Registerauszug, sondern direkt aus dem Bestand der Bundesagentur für Arbeit. Damit sind wir nicht in einer Grauzone, sondern mitten in einem behördlichen Datenzugriff – intern weitergereicht, aber mit Außenwirkung bei dir im Briefkasten.
- Zweckbehauptung: Die Weitergabe wird mit „wissenschaftlichen Zwecken“ begründet. Im Klartext: Weil es Forschung sein soll, gelten Sonderregeln, auf die sich das IAB beruft (u. a. § 282 Abs. 5 SGB III, der im Schreiben erwähnt wird). Das ist der juristische Hebel, um ohne vorherige Einwilligung eine Erstkontaktaufnahme zu rechtfertigen.
- Folgerisiko: Derselbe Satz taucht auch in der Erinnerung wieder auf – also in einem zweiten Schreiben, obwohl du auf das erste bewusst nicht reagiert hast. Dadurch wird aus der einmaligen Kontaktaufnahme de facto ein Nachfassen, das rechtlich nicht ausdrücklich vorgesehen ist und die behauptete „Freiwilligkeit“ spürbar aushöhlt.
Brisant ist dabei nicht nur, dass deine Adresse genutzt wurde, sondern wie selbstverständlich das im Text verpackt ist: ein einziger Satz, der klingt, als wäre das die normalste Sache der Welt. Für dich als Empfänger heißt das: Die Behörde greift auf einen zentralen Datenpool zu, filtert Adressen und verschickt personalisierte Einladungen samt Zugangscode – erst freundlich, dann „erinnernd“. Dass dieser Mechanismus überhaupt ohne deine vorherige Zustimmung greift, ist genau der Punkt, an dem sich die Datenschutz-Debatte entzündet.
§ 282 Abs. 5 SGB III – der Freifahrtschein für „wissenschaftliche Zwecke“
Der ganze Zauber steckt in § 282 Absatz 5 des Sozialgesetzbuches III (SGB III).
Übersetzt in Klartext heißt das:
- Die Bundesagentur für Arbeit (BA) darf ihre eigenen Daten an das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) weitergeben, und das IAB darf diese für wissenschaftliche Zwecke nutzen.
- Dazu gehört ausdrücklich, dass das IAB Befragungen durchführen darf – also Bürger anschreiben, um zusätzliche Informationen zu erheben.
- Die Teilnahme ist freiwillig, eine Auskunftspflicht besteht nicht.
- Die Daten müssen gegen unbefugten Zugriff geschützt, so früh wie möglich anonymisiert und getrennt von Identifizierungsmerkmalen gespeichert werden.
Diese Regelung ist die rechtliche Grundlage, auf die sich das IAB beruft, um Menschen ohne vorherige Einwilligung zu kontaktieren.
Es darf also deine Adresse verwenden, um dich zu einer Studie einzuladen, solange die Daten nur zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt werden und anschließend anonymisiert in die Forschung einfließen.
Datenschutzrechtlich stützt man sich dabei zusätzlich auf Artikel 89 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der Forschung unter bestimmten Auflagen erlaubt, personenbezogene Daten zu verarbeiten – etwa wenn geeignete Garantien wie Datenminimierung, Zweckbindung und Anonymisierung gewährleistet sind.
In Deutschland ergänzt § 27 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) diese Regelung.
Was der Paragraf allerdings nicht sagt:
Von Erinnerungsschreiben oder mehrfachen Kontaktaufnahmen steht dort kein Wort.
Der § 282 SGB III rechtfertigt eine Einladung, aber keine Nachfassaktion, wenn jemand auf das erste Schreiben nicht reagiert.
Dass das IAB trotzdem ein zweites Mal schreibt, mag aus wissenschaftlicher Sicht mit „Repräsentativität“ begründet sein – gesetzlich abgesichert ist das nicht.
Kurz gesagt:
§ 282 Abs. 5 SGB III erlaubt die Einladung – nicht den Druck.
Forschung ja, aber mit klaren Grenzen:
- Nur wissenschaftlicher Zweck.
- Anonymisierung so früh wie möglich.
- Keine Pflicht zur Antwort.
- Keine Weitergabe der Ergebnisse an Verwaltung oder Jobcenter.
Alles darüber hinaus ist rechtlich dehnbar und moralisch fragwürdig – besonders, wenn Bürger, die bewusst nicht reagiert haben, erneut Post bekommen.
Warum auch Bürgergeld-Empfänger im System landen
Ich bekomme Bürgergeld und habe mit der Bundesagentur für Arbeit offiziell nichts zu tun – zuständig ist das Jobcenter. Und trotzdem landet genau meine Adresse in einer „wissenschaftlichen Stichprobe“ des IAB. Wie passt das zusammen? Die kurze Antwort: Weil das Datensystem dahinter größer ist als die Zuständigkeiten im Schalterraum.
1) Gemeinsame Jobcenter = BA im Boot
In vielen Landkreisen (darunter auch Aurich) wird das Jobcenter als gemeinsame Einrichtung geführt: Landkreis + Bundesagentur zusammen. Heißt praktisch:
- Fachverfahren, IT und Teile der Datenhaltung laufen unter dem Dach der BA.
- Wer Bürgergeld bezieht, taucht damit technisch auch in BA-Beständen auf (Stammdaten wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, Fallkennzeichen etc.).
Das reicht dem IAB, um auf Basis von § 282 Abs. 5 SGB III Kontaktdaten für eine Einladung zu ziehen – auch ohne Einwilligung.
2) Lebenslaufspuren in BA-Daten – selbst ohne ALG I
Viele Menschen landen unabhängig vom Leistungsbezug irgendwann in BA-Daten:
- Beschäftigungsmeldungen der Arbeitgeber (über den Sozialversicherungsweg) fließen in Arbeitsmarktstatistiken der BA ein.
- Frühere Meldungen als arbeits- oder ausbildungssuchend, Bewerberprofile, Maßnahmenteilnahmen.
- Berufliche Weiterbildungen mit BA-Beteiligung, Beratungstermine, eService-Nutzungen.
Kurz: Auch wenn aktuell „nur“ Bürgergeld bezogen wird, existieren oft ältere oder parallele Datenspuren bei der BA.
3) Datenbrücke Forschung ↔ Verwaltung (mit Schotten)
Das IAB ist die Forschungseinrichtung der BA. Der Gesetzgeber erlaubt ausdrücklich, dass die BA Kontaktdaten für Forschungszwecke ans IAB gibt. Die Forschenden sollen Ergebnisse anonym veröffentlichen; Identitätsmerkmale werden getrennt gespeichert. Verwaltung (z. B. das Jobcenter) bekommt keine Antworten zurück.
Für die Einladung genügt: Name + Anschrift aus BA-Stammdaten.
4) „Zufallsauswahl“ heißt: Zufall aus einem Datenpool
Die Auswahl ist nicht der zufällige Griff ins Telefonbuch, sondern ein statistisches Sample aus BA-Beständen. Wer in diesem Pool sichtbar ist (gemeinsames Jobcenter, frühere BA-Vorgänge, SV-Meldungen), kann „zufällig“ gezogen werden – auch als Bürgergeld-Bezieher.
5) Optionskommunen wären die Ausnahme
Nur dort, wo das Jobcenter als Optionskommune rein kommunal arbeitet (ohne BA-Trägerschaft), liegen SGB-II-Daten nicht in BA-Systemen. Dann müsste die Kontaktbasis enger sein. In gemeinsamen Einrichtungen gilt das Gegenteil – und das ist bundesweit der Regelfall.
Fazit:
Auch Bürgergeld-Empfänger landen im BA-System, sobald das Jobcenter gemeinsam mit der BA betrieben wird oder frühere BA-Bezüge/Arbeitsmarktspuren existieren. Genau deshalb kann das IAB rechtlich zulässig Einladungen verschicken – was es nicht automatisch legitim sympathisch macht. Die Erstkontaktaufnahme ist gesetzlich abgedeckt; der Erinnerungsbrief dehnt die Grenze der Freiwilligkeit.
„Wissenschaftlich“ heißt nicht „freiwillig“
Wenn Behörden das Wort „wissenschaftlich“ benutzen, klingt das immer nach Objektivität, Neutralität und edlem Erkenntnisgewinn.
In der Praxis wird es aber oft zum Tarnmantel für Dinge, die sonst datenschutzrechtlich kaum durchgingen.
So auch hier: Das IAB betont an mehreren Stellen, dass die Befragung „freiwillig“ sei – und gleichzeitig, dass meine Adresse „von der Bundesagentur für Arbeit übermittelt“ wurde.
Damit beginnt der Widerspruch:
Wie freiwillig ist etwas, das schon im ersten Schritt ohne Einwilligung beginnt?
Wenn ich nie gefragt wurde, ob meine Daten weitergegeben werden dürfen, und dann Post bekomme, die sich auf genau diese Weitergabe stützt, ist das mit echter Freiwilligkeit schwer vereinbar.
Im Ergebnis entsteht ein System, das zwar juristisch sauber wirkt, aber moralisch schief hängt:
Ein staatliches Institut darf sich an meinen Daten bedienen, mich persönlich anschreiben und das Ganze „wissenschaftliche Forschung“ nennen – und ich darf dann dankbar entscheiden, ob ich teilnehme oder nicht.
So sieht formale Freiwilligkeit aus, wenn sie in einem Datennetz beginnt, aus dem man praktisch nicht mehr herauskommt.
Wie Datenschutz plötzlich zur Nebensache wird
Auf dem Papier klingt alles vorbildlich:
Die Daten würden „streng vertraulich“ behandelt, die Befragung sei „anonym“, die Teilnahme „freiwillig“, die Auswertung diene ausschließlich „wissenschaftlichen Zwecken“.
Wer den Brief nur oberflächlich liest, könnte fast den Eindruck bekommen, hier sei der Datenschutz der heimliche Hauptdarsteller.
In der Realität ist es genau andersherum: Der Datenschutz spielt nur die Nebenrolle, damit das Ganze gut aussieht – die Hauptrolle hat der Datenzugriff.
Fängt schon beim ersten Schritt an:
Ich wurde nicht gefragt, ob meine Adresse überhaupt für so eine Befragung verwendet werden darf.
Es gab keine Info à la: „Möchten Sie der Nutzung Ihrer Daten für wissenschaftliche Studien zustimmen?“
Stattdessen stand einfach im Brief:
Die Kontaktdaten wurden von der Bundesagentur für Arbeit ans IAB übermittelt – fertig.
Der Datenschutz taucht erst dann auf, wenn der Brief schon im Kasten liegt und der erste Zugriff längst passiert ist.
Auch die ständige Betonung der Anonymität wirkt auf den ersten Blick beruhigend.
Ja – die Antworten sollen später ohne Namen ausgewertet werden. Das ist gut und wichtig.
Aber:
Um mich überhaupt zu erreichen, mussten Name und Adresse mit vollem Personenbezug aus dem System gezogen werden.
Anonym ist hier nur der Endzustand, nicht der Weg dahin.
Und genau dieser Weg wird im Schreiben bewusst weichgezeichnet.
Hinzu kommt die schöne Formulierung, die Teilnahme sei „freiwillig“.
Juristisch mag das stimmen – niemand wird gezwungen, den QR-Code zu scannen.
Aber wie freiwillig fühlt sich das an, wenn ich ungefragt in eine Stichprobe gezogen, personalisiert angeschrieben und später sogar noch einmal erinnert werde, obwohl ich schon beim ersten Mal geschwiegen habe?
Freiwilligkeit sieht für mich anders aus.
Hier wirkt sie eher wie ein Feigenblatt, mit dem man sich den Zugang zu Daten schönredet:
„Du musst ja nicht – aber wir haben uns schon mal bedient.“
Auffällig ist auch, wann der Datenschutz im Brief überhaupt erwähnt wird:
Meist auf der Rückseite, irgendwo im unteren Teil der Seite, zwischen Standardtexten zur DSGVO.
Formal ist damit alles erfüllt, inhaltlich bleibt es bei Beruhigungsvokabular.
Kein Wort darüber, dass man auch einfach darauf verzichten könnte, Bürger ohne Einwilligung zu kontaktieren.
Kein Hinweis darauf, dass wissenschaftliche Forschung auch funktionieren kann, ohne sich aus dem Verwaltungsdatenpool zu bedienen.
Unterm Strich entsteht bei mir der Eindruck:
Der Datenschutz ist hier vor allem ein Deko-Element, das nach außen Seriosität vermitteln soll.
Die eigentliche Priorität liegt auf etwas ganz anderem:
Möglichst effizient und ohne große Hürden an möglichst viele Menschen heranzukommen, die im Datensystem der Bundesagentur erfasst sind.
Ob ich das will, spielt dabei keine Rolle.
Und genau an diesem Punkt wird aus „Datenschutz wird beachtet“ ziemlich deutlich:
Datenschutz wird mitgenommen, solange er nicht stört.
Warum Einwilligung hier keine Rolle spielt
In fast jedem Datenschutzhinweis liest man heutzutage:
„Wir verarbeiten Ihre Daten nur mit Ihrer Einwilligung.“
Bei Cookies wird gefragt, bei Newslettern wird gefragt, bei Gewinnspielen wird gefragt.
Nur hier – wo eine Behörde direkt auf einen riesigen Datenbestand zugreift und mich persönlich anschreibt – spielt Einwilligung plötzlich keine Rolle mehr.
Der Grund ist simpel und gleichzeitig ziemlich dreist:
Man beruft sich auf eine gesetzliche Grundlage, konkret auf § 282 SGB III und die Forschungsklauseln in DSGVO/BDSG.
Damit wird gesagt: „Wir brauchen Ihre Einwilligung nicht, weil der Gesetzgeber uns diese Nutzung bereits erlaubt hat.“
Mit anderen Worten: Statt dich zu fragen, hat der Staat einmal pauschal „Ja“ für dich gesagt.
Für mich als Betroffenen macht das einen entscheidenden Unterschied:
- Bei einem Newsletter kann ich entscheiden, ob ich ihn überhaupt bekomme.
- Bei einer Studie wie dieser bekomme ich den Brief ohne vorher gefragt zu werden – und darf dann hinterher „freiwillig“ entscheiden, ob ich antworte.
Die Einwilligung rutscht damit ein Stück nach hinten: Nicht mehr bei der Datenweitergabe, sondern erst bei der Teilnahme an der Befragung.
Genau hier liegt der Knackpunkt:
Der heikle Teil – die Nutzung meiner Kontaktdaten – ist bereits passiert, bevor ich überhaupt eine Wahl habe.
Ich werde Forschungsmaterial auf Abruf, ob ich das will oder nicht.
Meine „Freiwilligkeit“ beginnt erst dann, wenn der Brief schon vor mir liegt und die Behörde sich bereits aus dem Datenpool bedient hat.
Juristisch heißt das:
- Die Datenverarbeitung für die Einladung stützt sich auf das Gesetz.
- Die Datenverarbeitung für meine Antworten (falls ich teilnehme) stützt sich dann auf meine Einwilligung.
Klingt sauber, fühlt sich aber nicht so an.
Denn der eigentliche Punkt, an dem ich wirklich gefragt werden müsste – nämlich:
„Dürfen wir Ihre Daten überhaupt für solche Studien verwenden?“
wird komplett übersprungen.
Hinzu kommt:
Von so einer gesetzlichen „Forschungserlaubnis“ erfährt man in der Regel erst dann, wenn man betroffen ist.
Vorher wird man nicht informiert, man unterschreibt nichts, man widerspricht nichts – man existiert einfach in einem Datensystem, aus dem man für „wissenschaftliche Zwecke“ herausgezogen werden kann.
Das hat wenig mit dem zu tun, was die meisten Menschen unter Selbstbestimmung über ihre Daten verstehen.
Kurz gesagt:
Einwilligung spielt hier keine Rolle, weil sie bewusst auf den bequemsten Zeitpunkt verschoben wurde – nämlich dahin, wo es um den Fragebogen geht und nicht mehr um den eigentlichen Bruch im Gefühl:
dass eine Behörde ohne mein Zutun meine Adresse nutzt, mich anschreibt und das Ganze anschließend „freiwillig“ nennt.
Was wirklich hinter dem Begriff „anonymisiert“ steckt
In den Schreiben wird mehrfach betont, dass die Befragung „anonym“ sei und die Angaben „nicht mit der Person in Verbindung gebracht“ würden.
Klingt beruhigend – ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn im behördlichen Kontext bedeutet „anonym“ etwas ganz anderes, als viele annehmen.
In der Theorie soll es so laufen:
Die Antworten der Befragten werden später von allen Identifikationsmerkmalen getrennt und nur als reine Datensätze ausgewertet.
Die Forschenden sehen dann beispielsweise:
„Männlich, mittleres Alter, Region XY, Einschätzung zu Thema Z …“
Aber sie sollen nicht erkennen können, welche konkrete Person hinter diesen Angaben steht.
Doch um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, muss im Hintergrund ein technischer Ablauf passieren, der mit tatsächlicher Anonymität zunächst sehr wenig zu tun hat:
1. Jede ausgewählte Person erhält einen individuellen Zugangscode.
Dieser Code ist eindeutig einer bestimmten Person zugeordnet – selbst wenn der Name im Fragebogen später nicht eingegeben wird.
2. Beim Start der Befragung werden die Antworten zunächst mit diesem Code verknüpft.
Das System weiß also während der Eingabe ganz genau, welcher Datensatz von welcher Person stammt.
3. Erst in einem späteren Schritt sollen diese Zuordnungsdaten entfernt oder getrennt gespeichert werden.
Erst dann spricht man von dem Zustand, den die Schreiben von Anfang an versprechen.
Das bedeutet:
„Anonymisiert“ trifft erst auf das Endprodukt zu, aber nicht auf den Prozess, der zur Datenerhebung führt.
Technisch liegt zunächst eine Pseudonymisierung vor:
Die Antworten sind zwar nicht direkt mit dem Namen gespeichert, können aber über den Zugangscode eindeutig zurückgeführt werden – solange diese Verknüpfung existiert.
Die tatsächliche Anonymität hängt also nicht von der Technik ab, sondern davon,
ob und wie konsequent die verantwortliche Stelle die Trennung von IDs und Antworten tatsächlich durchführt.
Und genau das ist der heikle Punkt:
Wer ungefragt aus einem Datenpool gezogen wird und dann zwei personalisierte Briefe erhält, soll anschließend darauf vertrauen,
dass dieselbe Stelle später wirklich alle Verknüpfungen löscht oder voneinander trennt.
Unterm Strich ist „anonymisiert“ hier weniger ein technischer Zustand als ein Vertrauensversprechen.
Und Vertrauen lässt sich schwer einfordern, wenn der Datenschutz bereits bei der Kontaktaufnahme zweimal zugunsten der Forschung ausgehebelt wurde.
Die Erinnerung – zweite Runde der „Freiwilligkeit“
Eigentlich hätte damit alles erledigt sein müssen.
Ich habe auf den ersten Brief bewusst nicht reagiert – ein klareres Zeichen für „kein Interesse“ gibt es kaum.
Doch nur zwei Wochen später, am 11. November, lag erneut Post vom IAB im Briefkasten.
Der erste Brief kam am 28. Oktober, und jetzt folgte die „Erinnerung“ – nahezu wortgleich, mit demselben Zugangscode und derselben angeblich freiwilligen Einladung.
Und genau hier zeigt sich, wie flexibel das Wort „freiwillig“ offenbar ausgelegt wird.
Freiwilligkeit bedeutet für mich:
- Ich werde gefragt,
- ich entscheide mich,
- und diese Entscheidung wird akzeptiert.
Doch hier sieht die Realität anders aus:
Ich reagiere nicht – und statt dass das akzeptiert wird, kommt einfach ein zweites Schreiben hinterher.
Was als freundliche Einladung begann, fühlt sich plötzlich wie ein Nachhaken an, ein zweiter Versuch, doch noch eine Reaktion zu bekommen.
Spätestens hier verschwimmt die Grenze zwischen „wissenschaftlicher Befragung“ und behördlicher Aufdringlichkeit spürbar.
Neues Schreiben, gleicher Inhalt
Als ich die Erinnerung in der Hand hielt, fiel mir als erstes auf: Sie unterscheidet sich kaum vom ursprünglichen Schreiben.
Gleiche Struktur, gleiche Formulierungen, sogar der gleiche Zugangscode – nur ein zusätzlicher Satz wurde ergänzt:
Die Teilnahme sei „noch bis zum 31.12.2025 möglich“.
Ansonsten war es praktisch eine Kopie des ersten Briefes.
Wieder dieselben Floskeln über „wissenschaftliche Studie“, „freiwillige Teilnahme“, „strenge Vertraulichkeit“, „anonyme Auswertung“.
Wieder dieselbe Begründung, woher die Adresse stammt: von der Bundesagentur für Arbeit.
Wieder derselbe QR-Code und dieselbe Internetadresse.
Es war, als hätte man den ersten Brief einfach erneut ausgedruckt – ohne sich zu fragen, ob sich meine Haltung in den zwei Wochen dazwischen vielleicht geändert haben könnte.
Denn eines ist klar:
Wenn jemand beim ersten Mal nicht reagiert, liegt das selten daran, dass er die Post vergessen hat.
In den meisten Fällen bedeutet Schweigen schlicht: kein Interesse, keine Teilnahme, keine Mitwirkung.
Doch das IAB behandelt diese Stille nicht als Entscheidung, sondern als Aufforderung, es noch einmal zu versuchen.
Dabei hatte sich seit dem ersten Schreiben nichts geändert – weder die Informationen, noch die Freiwilligkeit, noch der Inhalt des Fragebogens.
Lediglich der Ton der Erinnerung suggerierte unterschwellig, ich hätte möglicherweise „vergessen“, mitzumachen.
Das macht den zweiten Brief so problematisch:
Er bringt keinen neuen Informationswert, erfüllt keinen zusätzlichen Zweck und basiert ausschließlich auf der Tatsache, dass „mein“ persönlicher Zugangscode bisher nicht verwendet wurde.
Und genau das zeigt deutlich:
Der zweite Brief ist keine neue Einladung, sondern ein gezieltes Nachfassen anhand personenbezogener Daten.
Inhaltlich ist er also eine 1:1-Wiederholung, aber die Wirkung ist eine andere:
- Der erste Brief war eine Frage.
- Der zweite wirkt wie ein Stups.
- Und je nach Perspektive auch wie ein sanfter Druck: „Nun mach endlich.“
Wenn eine angeblich freiwillige Befragung bereits auf dieser Ebene mehrfach bei denselben Menschen nachfasst, stellt sich automatisch die Frage, ob hier wirklich noch „Wissenschaft“ am Werk ist – oder ob man versucht, eine gewünschte Rücklaufquote um jeden Preis zu erzwingen.
Warum das IAB nachfasst, obwohl ich nie reagiert habe
Die spannende Frage ist: Warum schreibt mich das IAB überhaupt ein zweites Mal an, obwohl ich auf den ersten Brief ganz bewusst nicht reagiert habe?
Die Antwort liegt weniger bei mir, sondern in der Logik von Statistik, Behörden und Forschungsapparat.
Aus Sicht des IAB sieht das ungefähr so aus:
- Man hat eine Stichprobe gezogen – also eine bestimmte Anzahl Menschen, die angeschrieben werden.
- Diese Stichprobe soll möglichst „repräsentativ“ sein, also ein realistisches Bild der Bevölkerung zeigen.
- Damit das klappt, braucht man eine ausreichend hohe Rücklaufquote – sonst wird die ganze Studie schnell zur teuren Alibi-Maßnahme.
Was passiert also, wenn viele angeschriebene Personen den ersten Brief ignorieren?
Genau: Die schöne, geplante Statistik kippt.
Zu wenig Rückläufe, zu stark verzerrte Antworten, zu viel Aufwand für zu wenig Daten.
Und genau hier kommt der Reflex aus der Verwaltung:
Nachfassen. Erinnern. Erinnerungswelle starten.
Das IAB wird sich das nicht groß im Einzelfall überlegen. Da sitzt niemand, der sagt:
„Oh, der hat nicht reagiert, den nerven wir jetzt noch mal persönlich.“
Stattdessen läuft das vermutlich so:
- Man schaut in die Datenbank: Welche Zugangscodes wurden nicht genutzt?
- Für diese Fälle wird automatisch eine zweite Briefwelle generiert.
- Alle bekommen noch einmal nahezu denselben Text – mit einem freundlichen „Sie können noch teilnehmen bis …“.
Fachlich wird das intern dann mit Begriffen wie
„Verbesserung der Ausschöpfungsquote“,
„Vermeidung systematischer Ausfälle“
oder „Sicherung der Repräsentativität“ begründet.
Übersetzt heißt das nichts anderes als:
„Wir haben Geld und Aufwand in diese Studie gesteckt – jetzt sollen bitte auch genug Leute antworten.“
Mein Nichtreagieren wird in dieser Logik nicht als Entscheidung respektiert,
sondern als technischer Status: „Code noch nicht verwendet.“
Und auf diesen Status wird dann mit der Erinnerung reagiert – völlig unabhängig davon,
ob da ein Mensch sitzt, der sich ganz bewusst dagegen entschieden hat.
Das ist genau der Punkt, an dem sich wissenschaftliche Interessen und Respekt vor persönlicher Entscheidung beißen.
Ja, aus Sicht der Forschung ist es nachvollziehbar, möglichst viele Antworten zu bekommen.
Aber aus Sicht der Betroffenen wirkt das so:
- Ich wurde ohne Einwilligung in die Stichprobe gezogen.
- Ich habe durch Nichtreagieren signalisiert, dass ich nicht mitmachen möchte.
- Und statt das zu akzeptieren, kommt noch ein Brief hinterher.
Damit verrutscht die Rolle:
Aus einem „Dürfen wir Sie etwas fragen?“ wird ein „Wir fragen einfach noch mal, bis Sie reagieren oder die Frist rum ist.“
Dieser Umgang mit Schweigen – nicht als Entscheidung, sondern als lästiges Hindernis – ist genau das, was für mich die Grenze überschreitet.
Kurz gesagt:
Das IAB fasst nicht nach, weil ich wichtig bin,
sondern weil ich in deren Statistik eine offene Variable bin.
Und genau daran sieht man, welchen Stellenwert meine persönliche Entscheidung im Vergleich zu ihrem Forschungsinteresse wirklich hat.
Die Erinnerung zeigt: So anonym ist das Ganze gar nicht
An diesem Punkt stellt sich automatisch die Frage:
Wenn das alles wirklich so anonym wäre, wie in beiden Schreiben behauptet wird – woher wissen sie dann überhaupt, dass ich nicht längst teilgenommen habe?
Die Antwort ist ernüchternd einfach:
Sie wissen es, weil es gar nicht anonym ist.
Zumindest nicht in dem entscheidenden Moment.
Ich habe einen persönlichen Zugangscode bekommen. Dieser Code ist nicht irgendeine zufällig generierte Zeichenfolge, sondern eindeutig meiner Person zugeordnet.
Würde ich die Befragung starten, würde das System registrieren:
„Dieser Code wurde eingelöst.“
Wenn ich nicht teilnehme, bleibt der Code ungenutzt – und genau diese Information wird für die Erinnerung verwendet.
Das bedeutet:
- Das IAB (oder der technische Dienstleister) kann exakt sehen, ob „mein“ Code verwendet wurde oder nicht.
- Es kann dadurch auch sehen, wer nicht reagiert hat.
- Und es kann zielgerichtet entscheiden, an wen ein zweiter Brief verschickt wird – nämlich genau an diejenigen, die nicht teilgenommen haben.
Wäre die Befragung wirklich anonym, müssten sie entweder jedem eine Erinnerung schicken (auch denen, die teilgenommen haben), oder niemandem.
Beides tun sie nicht.
Sie schreiben ausschließlich die Personen an, deren Codes unbenutzt geblieben sind.
Das zeigt klar:
Die Behauptung, die Befragung sei „anonym“, bezieht sich erst auf die spätere Datenauswertung – nicht auf den Prozess davor.
Während der Erhebung ist das Ganze personengenau nachvollziehbar.
Es handelt sich also um eine pseudonymisierte Befragung, die erst später – irgendwann – in einen anonymen Zustand überführt werden soll.
Und genau dieses Detail wird in den Schreiben elegant weggelassen.
Denn es würde den schönen, beruhigenden Anstrich der „anonymen wissenschaftlichen Befragung“ gehörig stören.
Ab wann „Forschung“ zur Belästigung wird
Dass Forschung Fragen stellt, ist normal.
Dass Behörden Daten nutzen, ist leider inzwischen auch normal.
Aber irgendwann kippt der Punkt, an dem aus einer erlaubten Anfrage eine spürbare Belästigung wird – und genau diesen Punkt hat das IAB für mich mit der Erinnerung überschritten.
Der erste Brief war schon grenzwertig:
- ungefragter Zugriff auf meine Adresse,
- „Zufallsauswahl“ aus einem Behörden-Datenpool,
- ein persönlicher Zugangscode,
- und eine Befragung, von der ich vorher nichts wusste und um die ich nicht gebeten habe.
Trotzdem kann man beim ersten Schreiben noch sagen:
Okay, sie dürfen das offenbar, es ist eine einmalige Einladung, ich schmeiße es weg und gut ist.
Dieser stillschweigende Deal funktioniert aber nur, solange meine Nicht-Reaktion akzeptiert wird.
In dem Moment, in dem ein zweiter Brief ins Haus flattert, ändert sich die Qualität der Situation:
- Aus einer einmaligen Einladung wird ein gezieltes Nachfassen.
- Aus „Sie können teilnehmen, wenn Sie möchten“ wird unterschwellig „Sie haben es wohl noch nicht erledigt“.
- Aus einer neutralen Anfrage wird ein beharrlicher Versuch, doch noch eine Reaktion zu provozieren.
Belästigung fängt für mich dort an, wo eine Stelle – zumal eine staatliche – nicht nur fragen, sondern auch nachdrücken zu müssen meint.
Zumal, wenn der Empfänger keinerlei Beziehung zu dieser Stelle empfindet und nie in irgendeine Datennutzung eingewilligt hat.
Dazu kommt das Machtgefälle:
Das hier ist kein Werbeblatt irgendeines Meinungsforschungsinstituts, das man ungelesen entsorgt.
Es ist ein Schreiben, das sich auf eine Bundesbehörde beruft, mit offiziellen Logos, akademischen Titeln und rechtlichen Verweisen.
Solche Briefe wirken automatisch amtlich und wichtig – selbst wenn sie es objektiv nicht sind.
Viele Menschen werden dadurch verunsichert und trauen sich nicht, solche Post einfach wegzulegen, aus Sorge, irgendetwas „Pflichtiges“ zu verpassen.
Wenn dann noch eine Erinnerung hinterhergeschickt wird, passiert Folgendes:
- Die gefühlte Verbindlichkeit steigt – obwohl die Teilnahme weiterhin absolut freiwillig ist.
- Die Hürde, einfach Nein zu sagen, wird größer – weil das Nein schon beim ersten Mal ignoriert wurde.
- Man wird nicht als Bürger mit Entscheidung, sondern als Datensatz, den man durch freundliches Drücken doch noch aktivieren möchte, behandelt.
Mit seriöser Forschung hat das wenig zu tun.
Seriöse Forschung respektiert ein „Nein“, ein „Kein Interesse“ und vor allem ein Schweigen.
Sie akzeptiert, dass Menschen nicht Teil von Studien sein wollen – aus Misstrauen, aus Prinzip oder einfach aus Desinteresse.
Wenn eine Behörde dagegen meint, eine erste Nicht-Reaktion sei nur ein technischer Status, den man mit einer zweiten Briefwelle „optimieren“ müsse, hat sie den Kontakt zur Lebensrealität verloren.
Dann ist der schöne Anstrich „wissenschaftlich“ nur noch eine Fassade, hinter der ein sehr praktisches Ziel steht:
die Rücklaufquote zu retten – egal, wie sich das für die Betroffenen anfühlt.
Für mich ist der Punkt eindeutig erreicht, wenn:
- Daten ohne Einwilligung aus einem Verwaltungsbestand gezogen werden,
- die erste Einladung bewusst ignoriert wird,
- und trotzdem eine gezielte Erinnerung verschickt wird.
Ab da reden wir nicht mehr über neutrale Forschung, sondern über ein Verhalten, das viele Menschen als das empfinden, was es ist:
aufdringlich, respektlos und datenschutzrechtlich mindestens fragwürdig.
Datenschutzrechtlich auf wackligen Beinen
Spätestens an diesem Punkt lohnt sich ein genauer Blick darauf, wie tragfähig die ganze Konstruktion eigentlich ist.
Denn während das IAB in seinen Schreiben stets betont, alles laufe „unter strikter Wahrung des Datenschutzes“, zeigt der praktische Ablauf etwas anderes:
Ein ungefragter Datenzugriff, eine persönliche Einladung, ein zweites Schreiben, ein weiterhin aktiver Zugangscode und eine technische Nachverfolgung darüber, wer teilgenommen hat und wer nicht.
Rein formal hält sich das Institut an einen Paragrafen, der der Bundesagentur für Arbeit bestimmte Forschungsbefugnisse einräumt.
Doch nur weil etwas irgendwo gesetzlich erlaubt ist, heißt das nicht automatisch, dass es datenschutzrechtlich sauber, verhältnismäßig oder bürgerfreundlich ist.
Zumal der Gesetzestext selbst viele Fragen offenlässt – und die Praxis des IAB zeigt, wie weit man diese Spielräume dehnen kann.
Genau an dieser Stelle wird deutlich:
Die Grenze zwischen „gesetzlich zulässig“ und „datenschutzrechtlich fragwürdig“ ist dünn.
Und je weiter man sich anschaut, wie diese Befugnisse umgesetzt werden, desto wackeliger wirkt der datenschutzrechtliche Unterbau.
Wo die gesetzlichen Grenzen liegen
Auf den ersten Blick wirkt es so, als hätte das IAB mit § 282 Abs. 5 SGB III einen großzügigen Freiraum, um Bürger zu wissenschaftlichen Zwecken anzuschreiben. Doch dieser Paragraf ist keineswegs eine Blankovollmacht. Er wurde ursprünglich geschaffen, um einzelne Forschungsprojekte zu ermöglichen – nicht, um Verwaltungsdaten beliebig und ohne Einwilligung zu nutzen. Und genau hier beginnt der Bereich, in dem die gesetzlichen Grenzen deutlich enger verlaufen, als die Schreiben des IAB vermuten lassen.
Zunächst erlaubt der Paragraf ausdrücklich nur eine einmalige Kontaktaufnahme. Das bedeutet: Das IAB darf Menschen schriftlich zu einer freiwilligen Befragung einladen, wenn diese Einladung für den Forschungszweck erforderlich ist. Mehr aber auch nicht. Von wiederholten Schreiben, Erinnerungen oder mehreren Kontaktversuchen ist im Gesetz keine Rede. Die zweite Briefwelle bewegt sich daher auf wackeligem Boden, denn die Erlaubnis für solche Nachfassaktionen wurde nie gesetzlich festgehalten. Dass der Gesetzgeber das nicht vorgesehen hat, ist kein Zufall: Eine einmalige Einladung soll ausreichen, und wer nicht teilnehmen möchte, hat damit sein Recht ausgeübt.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zweckbindung. Daten dürfen nur in dem Umfang genutzt werden, der für die wissenschaftliche Untersuchung erforderlich ist. Das bedeutet: Name und Adresse dürfen für die Einladung verwendet werden, aber nicht für darüber hinausgehende Zwecke. Wenn das IAB hingegen sehen kann, wer nicht teilgenommen hat – und genau diese Information nutzt, um eine Erinnerung zu verschicken –, dann wird die Grenze der Zweckbindung schnell sehr eng. Zwar mag die Erinnerung organisatorisch begründet werden, doch datenschutzrechtlich bleibt die Frage bestehen, ob diese zusätzliche Nutzung noch vom ursprünglichen Forschungszweck gedeckt ist.
Hinzu kommt die Pflicht zur frühestmöglichen Anonymisierung. Sobald identifizierende Daten für die Befragung nicht mehr notwendig sind, müssen sie getrennt werden. Das Gesetz spricht von einer Trennung der Identifikationsmerkmale und einer Anonymisierung, „sobald der Forschungszweck erreicht werden kann“. Wenn jedoch über Wochen hinweg sichtbar bleibt, welche Codes nicht eingelöst wurden, und genau dieser Status gezielt verarbeitet wird, dann liegt der Zeitpunkt der Anonymisierung deutlich später als notwendig. Das widerspricht zumindest dem Geist der gesetzlichen Vorgabe, die darauf ausgelegt ist, personenbezogene Daten so kurz wie möglich im System zu halten.
Auch die Freiwilligkeit spielt eine große Rolle. Der Gesetzgeber betont ausdrücklich, dass keine Auskunftspflicht besteht und aus einer Nichtteilnahme keinerlei Nachteile entstehen dürfen. Doch echte Freiwilligkeit setzt voraus, dass eine Nicht-Reaktion respektiert wird. Wenn stattdessen eine Erinnerung hinterherschickt wird, deutet das auf ein Verständnis hin, bei dem Schweigen nicht als Entscheidung, sondern als „zu korrigierender Zustand“ angesehen wird. Rechtlich ist das nicht verboten – aber es widerspricht der Idee einer freiwilligen Mitwirkung.
Schließlich greift auch die DSGVO. Selbst wenn § 282 SGB III eine nationale Grundlage bietet, müssen die Prinzipien der DSGVO trotzdem erfüllt sein: Transparenz, Datenminimierung, Zweckbindung und Erforderlichkeit. Und genau bei der Erforderlichkeit stellt sich die Frage: Ist ein zweites Schreiben wirklich notwendig, oder geht es lediglich darum, die Rücklaufquote zu erhöhen? Wissenschaftlich mag eine höhere Ausschöpfung wünschenswert sein, datenschutzrechtlich ist sie jedoch nicht zwingend erforderlich. Damit wird die Erinnerung eher zum Komfortinstrument für die Forschung – und nicht zum notwendigen Bestandteil eines rechtlich abgesicherten Verfahrens.
Zusammengefasst zeigt sich: Die gesetzlichen Grenzen sind deutlich enger gesteckt, als der nüchterne Hinweis im Schreiben vermuten lässt. Erlaubt ist eine einmalige Einladung, die Nutzung der Adresse für diesen Zweck und die spätere Auswertung anonymisierter Daten. Nicht vorgesehen ist eine dauerhafte Nutzung personenbezogener Informationen, um den Teilnahmestatus zu überwachen oder gezielt nachzufassen. Genau deshalb steht die Erinnerung des IAB auf datenschutzrechtlich wackeligen Beinen – auch wenn das Institut sie als harmlosen Service verkaufen möchte.
Warum § 282 SGB III nicht alles rechtfertigt
Wenn man vom IAB angeschrieben wird, taucht früher oder später immer derselbe Satz auf: Man berufe sich auf § 282 SGB III, alles sei gesetzlich gedeckt, Datenschutz werde selbstverständlich beachtet. Das klingt so, als wäre damit jede Kritik erledigt – nach dem Motto: „Steht doch im Gesetz, also ist es in Ordnung.“ Genau diese Haltung ist das Problem. Denn ein Paragraf, der Forschungszugriffe erlaubt, ist keine pauschale Rechtfertigung dafür, jede Gelegenheit maximal auszureizen.
§ 282 SGB III sagt im Kern nur: Die Bundesagentur für Arbeit darf Daten zu wissenschaftlichen Zwecken nutzen, und das IAB darf Menschen kontaktieren, um Informationen zu erheben, die nicht aus vorhandenen Verwaltungsdaten ableitbar sind. Damit ist ausschließlich das „Ob“ geklärt – also dass eine Kontaktaufnahme grundsätzlich möglich ist. Was der Paragraf jedoch nicht regelt, ist das „Wie“. Und genau dort fängt das eigentliche Problem an: Nicht jede Umsetzung, die formal denkbar wäre, ist automatisch verhältnismäßig, respektvoll oder datenschutzfreundlich.
Eine einmalige Einladung kann man noch als vertretbar betrachten. Sie ist erlaubt, sachlich begründet und bleibt im Rahmen des Gesetzes. Doch das Verhalten des IAB geht darüber hinaus. Aus der ursprünglichen Einladung wurde eine Erinnerung, und aus einer einfachen Kontaktaufnahme eine zweite, gezielte Anschrift, die ausschließlich darauf beruht, dass ein persönlicher Zugangscode bislang nicht eingelöst wurde. Damit verschiebt sich die Auslegung des Gesetzes von „Ermöglichen“ zu „maximalem Ausschöpfen“. Der Geist des Gesetzes – nämlich Forschung zu ermöglichen, nicht Menschen zu bedrängen – gerät dabei aus dem Blick.
Hinzu kommt, dass § 282 SGB III nicht isoliert betrachtet werden darf. Er steht im Kontext der DSGVO, dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Nur weil eine Norm eine Datenverarbeitung erlaubt, bedeutet das nicht, dass jede praktische Anwendung dieser Norm automatisch legitim ist. Rechtsprechung und Datenschutzaufsichten betonen immer wieder, dass selbst bei einer gesetzlichen Grundlage zusätzliche Kriterien erfüllt sein müssen: minimale Eingriffe, sparsame Nutzung von Daten, und ein Vorgehen, das die Rechte der Betroffenen respektiert. Eine Erinnerungsschreiben-Welle, die allein auf ausbleibende Teilnahmen reagiert, erfüllt diesen Anspruch nur schwerlich.
Ein weiterer Aspekt ist die technische Entwicklung. Als der Gesetzgeber den Paragrafen schuf, konnte kaum jemand die heutigen Möglichkeiten personalisierter Codes, automatisierter Nachverfolgung und algorithmisch erzeugter Serienbriefe vorhersehen. Der Paragraf mag den Zugriff auf Daten erlauben, doch er wurde nicht für ein Umfeld geschrieben, in dem die technische Umsetzung praktisch unbegrenzte Präzision ermöglicht. Ein Gesetz, das ursprünglich eine Tür öffnen sollte, wird so schnell zu einem Tor, das weit über den damaligen Zweck hinaus genutzt wird.
Entscheidend ist auch die moralische Dimension. In keinem Paragrafen steht, wie eine Behörde mit ihren Rechten umgehen sollte – nur, was sie theoretisch darf. Es ist ein großer Unterschied, ob eine Datenbefugnis mit Zurückhaltung eingesetzt wird oder ob man jede Lücke ausnutzt, die das Gesetz offenlässt. Im Fall des IAB wirkt es eher so, als habe man sich dafür entschieden, die gesetzliche Erlaubnis bis an die Grenze auszureizen: erst ungefragte Datenübermittlung, dann personalisierte Einladung, dann Erinnerung.
Kurz gesagt: § 282 SGB III mag eine rechtliche Grundlage bieten, aber er rechtfertigt nicht automatisch jede praktische Ausgestaltung. Er erklärt, warum das IAB solche Briefe verschicken darf – aber nicht, warum es das so tun sollte. Und schon gar nicht nimmt er dem Institut die Verantwortung ab, mit den eigenen Befugnissen sorgsam und zurückhaltend umzugehen, statt sie bis an die Schmerzgrenze auszureizen.
Stimmen von Datenschützern: Graubereich oder klarer Verstoß?
Fragt man Datenschützer nach ihrer Einschätzung zu solchen Befragungen, hört man selten ein überzeugtes „alles in Ordnung“. Stattdessen fällt häufig das Wort „Graubereich“. Zwar schafft § 282 SGB III eine formelle Rechtsgrundlage, doch viele Experten zweifeln daran, dass die konkrete Umsetzung des IAB den datenschutzrechtlichen Anforderungen wirklich gerecht wird. Besonders die zweite Briefwelle stößt bei Fachleuten auf deutliche Kritik.
Ein zentraler Punkt ist die Frage der Verhältnismäßigkeit. Datenschützer betonen immer wieder, dass eine gesetzliche Erlaubnis kein Freifahrtschein ist, um sämtliche Spielräume auszureizen. Eine einmalige Einladung mag noch notwendig sein, um Daten zu erheben, die anders nicht verfügbar wären. Doch eine Erinnerung an alle Personen, deren Zugangscode ungenutzt geblieben ist, wird von vielen als nicht mehr erforderlich angesehen. Sie dient primär dazu, die Rücklaufquote zu erhöhen – nicht, um den eigentlichen Forschungszweck zu ermöglichen. Genau hier sehen Fachleute den Übergang vom zulässigen Handeln in einen Bereich, der zumindest datenschutzrechtlich fragwürdig ist.
Hinzu kommen erhebliche Transparenzprobleme. Bürger erfahren weder, wie lange ihre personenbezogenen Daten mit dem Zugangscode verknüpft bleiben, noch wie diese technischen Prozesse konkret ablaufen. Während in den Schreiben von „frühestmöglicher Anonymisierung“ die Rede ist, zeigt die versandte Erinnerung, dass die Zuordnung zwischen Person und Teilnahmestatus offensichtlich weiterhin besteht. Für viele Datenschützer ist das ein Widerspruch: Eine angeblich anonyme Befragung, deren Status dennoch individuell nachverfolgt werden kann, erfüllt den Transparenzgrundsatz der DSGVO nur unzureichend.
Auch die Frage der Freiwilligkeit wird häufig kritisiert. Aus datenschutzrechtlicher Sicht gilt eine Teilnahme nur dann als freiwillig, wenn ein „Nein“ respektiert wird – und zwar endgültig. Eine Erinnerung, die gezielt auf eine Nicht-Reaktion abzielt, verwässert diese Freiwilligkeit. Selbst wenn keine Sanktionen drohen, erzeugt ein zweites Anschreiben eine psychologische Drucksituation, die gerade bei Behördenpost nicht unterschätzt werden darf. Viele Fachleute argumentieren daher, dass derartige Erinnerungen die Grenze zwischen „freiwilliger Teilnahme“ und „sanftem Druck“ überschreiten.
Manche Datenschützer gehen sogar noch weiter und sprechen von einem strukturellen Problem: Die gesetzliche Erlaubnis für wissenschaftliche Forschung sei so offen formuliert, dass Behörden sie äußerst weit auslegen können. Was ursprünglich als Grundlage für ausgewählte Studien gedacht war, werde durch moderne IT-Strukturen zu einem Instrument, mit dem personalisierte Massenbefragungen möglich sind. Nicht der Paragraf selbst sei das Kernproblem, sondern die Kombination aus vagen gesetzlichen Formulierungen, technischer Machbarkeit und fehlender Kontrolle darüber, wie die Daten im Detail verarbeitet werden. Aus dieser Perspektive ist die Erinnerung des IAB nicht nur ein Graubereich, sondern ein Hinweis darauf, dass das gesamte System zu weit geöffnet wurde.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die angebliche Anonymität. Wenn eine Behörde genau erkennen kann, wer teilgenommen hat und wer nicht, ist das Verfahren technisch gesehen nicht anonym, sondern pseudonymisiert. Dass in den Schreiben dennoch von „anonym“ die Rede ist, sehen viele als klare Irreführung – zumindest im Hinblick auf den Transparenzgrundsatz der DSGVO. Eine echte anonyme Befragung würde nicht ermöglichen, einzelne Nicht-Teilnehmer gezielt anzuschreiben.
Zusammengefasst: Datenschützer sind sich selten einig, ob der Vorgang ein eindeutiger Verstoß oder ein komplexer Graubereich ist. Doch in einem Punkt herrscht weitgehend Konsens: Die aktuelle Praxis des IAB erfüllt zwar minimale gesetzliche Anforderungen, verfehlt jedoch den Anspruch, datensparsam, transparent und mit echtem Respekt vor der Entscheidung der Betroffenen zu handeln. Der Paragraf mag die Tür öffnen – doch das Verhalten dahinter lässt viele Experten den Kopf schütteln.
Was das alles über Behördenkultur sagt
Wenn man den Vorgang als Ganzes betrachtet – die ungefragte Datenübermittlung, die formelhafte Einladung, die personalisierte Erinnerung, die Beschwichtigungsfloskeln zum Datenschutz –, dann zeigt sich mehr als nur eine fragwürdige Studie. Es zeigt sich ein Stück Behördenkultur, das vielen Menschen vertraut vorkommt: eine Kultur, in der man lieber formal korrekt handelt, als darüber nachzudenken, wie sich das für die Betroffenen anfühlt. Eine Kultur, in der man Zuständigkeiten und Gesetzesabschnitte perfekt zitieren kann, aber selten fragt, ob das Vorgehen wirklich sinnvoll, respektvoll oder verhältnismäßig ist. Der Fall des IAB ist deshalb nicht nur ein Datenschutzthema – er ist ein Symptom für ein tiefer liegendes Problem im Umgang staatlicher Stellen mit den Daten und der Lebenswirklichkeit der Menschen, die sie verwalten.
Bürokratische Selbstbedienungsmentalität unter dem Deckmantel der Wissenschaft
Der Fall zeigt ein Verhalten, das man leider immer wieder in staatlichen Strukturen beobachten kann: eine Art bürokratische Selbstbedienungsmentalität, die sich elegant hinter dem Begriff „Wissenschaft“ versteckt.
Denn sobald eine Behörde das Wort „Forschung“ ins Spiel bringt, scheint plötzlich alles erlaubt zu sein, was im normalen Verwaltungsalltag undenkbar wäre – insbesondere beim Umgang mit persönlichen Daten.
Was hier passiert, ist im Grunde ein typischer Behördenreflex:
„Wir dürfen das – also machen wir es auch.“
Dass dieses „Dürfen“ nur innerhalb eines engen gesetzlichen Rahmens gilt und der Umgang damit sensibel sein sollte, tritt dabei schnell in den Hintergrund.
Man wählt den bequemsten Weg – und nicht den verantwortungsvollsten.
Der wissenschaftliche Anstrich dient dabei wie ein perfekter Schutzschild.
Wer wollte schon etwas gegen „Arbeitsmarktforschung“ haben?
Das klingt neutral, objektiv, sachlich.
Doch genau hinter diesem Etikett versteckt sich ein Vorgehen, das im Kern erstaunlich unbedarft ist:
- Man hat Zugriff auf Millionen von Datensätzen.
- Man kann Adressen ohne Einwilligung ziehen.
- Man kann personalisierte Codes generieren.
- Man kann Nicht-Reaktionen technisch erfassen.
- Und man kann all das nutzen, ohne die Betroffenen vorher zu informieren oder um Zustimmung zu bitten.
Diese Haltung zeigt eine gefährliche Normalisierung:
Daten werden nicht als schutzbedürftige Informationen behandelt, sondern als Ressource, die man nach Belieben abrufen kann – wie Material aus dem eigenen Lager.
Dass dahinter Menschen stehen, die sich vielleicht unwohl fühlen, misstrauisch werden oder sich schlicht nicht ungefragt in Studien ziehen lassen wollen, spielt im behördlichen Automatismus kaum eine Rolle.
Der Begriff „wissenschaftlich“ wirkt wie ein Zauberwort.
Er verwandelt einen Vorgang, der bei jeder privatwirtschaftlichen Firma sofort einen massiven Datenschutzskandal auslösen würde, in etwas scheinbar Legales, Harmloses, Serioses.
Dabei bleibt unberührt, wie diese „wissenschaftlichen Zwecke“ tatsächlich umgesetzt werden – und ob sie noch etwas mit dem zu tun haben, was man vernünftige Forschung nennen würde.
Man merkt deutlich, dass es nicht um Respekt gegenüber den Betroffenen geht, sondern um Effizienz aus Sicht der Behörde.
Es ist einfacher, Daten einfach zu nehmen, als nach Zustimmung zu fragen.
Es ist einfacher, Millionen Adressen in einem System zu haben, als gezielt Menschen anzusprechen, die wirklich freiwillig mitmachen wollen.
Und es ist einfacher, eine Erinnerung zu schicken, als sich mit der Frage zu beschäftigen, warum viele Menschen solche Post bewusst ignorieren.
Das alles zeigt eine Mentalität, die nicht auf Augenhöhe arbeitet, sondern von oben nach unten:
„Wir haben Daten, wir verwalten Daten, wir nutzen Daten – fertig.“
Die Betroffenen werden dabei nicht als Menschen gesehen, sondern als Elemente einer Stichprobe, als Teil eines Datensatzes, als variable Größe in einer Forschungstabelle.
Das ist kein Einzelfall.
Es ist ein Grundmuster von Behördenkultur:
Formell korrekt, praktisch bequem, menschlich distanziert.
Und der wissenschaftliche Anstrich macht es noch leichter, die eigenen Pflichten weichzuzeichnen und Kritik im Keim zu ersticken.
Am Ende bleibt ein bitterer Eindruck:
Nicht die Wissenschaft ist hier der Motor, sondern die Bequemlichkeit.
Und nicht der Datenschutz ist die Leitlinie, sondern der behördliche Zugriff, der zur Routine geworden ist – selbst dann, wenn er moralisch längst überdehnt wurde.
Wenn du möchtest, schreibe ich als Nächstes den Abschnitt
„Was das über Respekt gegenüber Bürgern aussagt“
oder – falls du der Gliederung folgen willst – „Datenschutz als lästige Formalie“.
Geld, Zeit und Papier – für nichts
Wenn man sich das Ganze einmal nüchtern anschaut, bleibt eine Frage besonders hängen: Warum wird für so etwas überhaupt Geld ausgegeben?
Zwei Briefe, gedruckt, kuvertiert, verschickt – jeweils mit personalisiertem Code, professionell gestaltet und offenbar automatisiert in großer Stückzahl produziert. Das alles kostet nicht nur ein paar Euro Porto, sondern vor allem Steuergeld. Und zwar für ein Ergebnis, das im Zweifel exakt null Mehrwert bringt, wenn der angeschriebene Bürger – so wie ich – schlicht kein Interesse hat.
Fangen wir beim Offensichtlichen an:
Schon der erste Brief war überflüssig. Ich habe weder um eine Befragung gebeten noch je erklärt, dass ich an wissenschaftlichen Studien der Bundesagentur teilnehmen möchte. Und doch landet ein Schreiben im Kasten, das dafür produziert wurde, dass ein paar Prozent der Leute vielleicht antworten. Die restlichen – wahrscheinlich die Mehrheit – werfen das Ganze sofort weg. Ein einziger Brief dieser Art ist schon fragwürdig, aber immerhin noch einmalig.
Doch dann kommt zwei Wochen später eine Erinnerung – fast wortgleich, gleiche Gestaltung, gleiche Herstellungskosten. Egal, ob ich nicht reagiert habe, weil ich keine Zeit hatte, kein Interesse oder den Brief einfach nicht wollte: Man geht stumpf davon aus, dass ein zweites Schreiben die Lösung ist. Eine Art behördliche Trotzreaktion – „der wird schon irgendwann“.
Und damit wird das Ganze endgültig absurd.
Denn mit jedem einzelnen Brief entstehen:
- Kosten für Druck und Papier
- Kosten für Kuverts
- Kosten für Porto
- Kosten für Personal oder externe Dienstleister
- Kosten für IT-Systeme, die Codes generieren, Statistiken erstellen und Serienbriefe erzeugen
- Kosten für Verwaltung, die das alles koordiniert
- und natürlich Kosten für die eigentliche Durchführung der Studie, die mit jedem unnötigen Schreiben weiter aufgebläht wird
Das Traurige:
Es gibt keinen erkennbaren Nutzen.
Der zweite Brief bringt keinerlei neue Information, kein neues Argument, keinen neuen Ansatz – er ist einfach nur ein „Na los, mach schon“. Ein Schubser, der in einer privaten Firma als schlechte Kundenpflege gelten würde, aber hier als „Wissenschaft“ verkauft wird.
Dazu kommt die vollkommen unnötige Umweltbelastung. Wir reden über:
- hunderte oder tausende Briefe,
- Millionen Seiten Papier,
- Toner,
- Verpackungsmaterial,
- Transport durch die Post,
- Energie für Produktion, Logistik und IT.
Alles, damit am Ende vielleicht ein paar Prozentpunkte mehr Rücklauf generiert werden. In einer Zeit, in der Behörden predigen, man solle digital kommunizieren, Kosten senken und Ressourcen schonen, verschickt das IAB ganz selbstverständlich Papierwellen auf Basis einer Datenübermittlung, die nie mit den Betroffenen abgeklärt wurde.
Der Effekt:
Das Vertrauen sinkt, die Kosten steigen – und das Ergebnis hat keinerlei Heldenpotenzial.
Denn wie viele Bürger werden durch ein Erinnerungsschreiben tatsächlich plötzlich motiviert, an einer Studie teilzunehmen?
Die überwältigende Mehrheit wird genau das tun, was ich getan habe:
den zweiten Brief genauso wegwerfen wie den ersten.
Unterm Strich ist das Ganze daher ein Paradebeispiel dafür, wie Behörden mit Steuergeld umgehen können, wenn es niemanden gibt, der sie bremst.
Ein System, das automatisch Briefe verschickt, ohne zu reflektieren, ob sie sinnvoll sind, ob sie jemanden erreichen oder ob es nicht effizientere und respektvollere Methoden gäbe, wirkt eher wie ein veralteter Automatismus als wie eine moderne Behörde.
Was bleibt, sind Berge von Briefen, unnötige Kosten und eine Studie, die in vielen Fällen genauso gut oder schlecht funktioniert hätte – ohne die Erinnerung, ohne den Aufwand und ohne den Ärger.
Wenn du möchtest, schreibe ich als Nächstes „Was Betroffene am Ende übrig behalten: Zweifel und Misstrauen“ oder „Warum solche Aktionen dem Vertrauen in Behörden mehr schaden als nutzen“.
Warum solche Aktionen Vertrauen zerstören
Vertrauen in Behörden ist nichts, was man sich per Gesetz verordnen kann. Es entsteht – oder zerbricht – im Alltag, bei ganz konkreten Erfahrungen. Genau so eine Erfahrung ist es, wenn man ungefragt Post bekommt, die auf einem Datenzugriff basiert, den man nie bewusst erlaubt hat. Und wenn dann, wie in meinem Fall, nach einem ignorierten Schreiben noch eine Erinnerung hinterherkommt, ist der Schaden größer als alles, was eine „wissenschaftliche Studie“ jemals an Erkenntnis bringen kann.
Das fängt schon bei einem ganz einfachen Gefühl an: Ich habe den ersten Brief ganz bewusst nicht beantwortet. Für mich war das meine Entscheidung. Kein Interesse, kein Bedarf, kein Vertrauen – fertig. Anstatt diese Entscheidung zu respektieren, wertet das IAB mein Schweigen aber offenbar nur als fehlenden Impuls, dem man noch einmal nachhelfen muss. Damit wird mir sehr deutlich gezeigt: Meine Haltung interessiert eigentlich niemanden. Ich bin kein Bürger mit einer Entscheidung, ich bin ein Datensatz, der noch nicht „aktiviert“ wurde.
Genau das frisst Vertrauen. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier jemand sensibel mit meinen Daten umgeht, abwägt oder Respekt zeigt. Im Gegenteil: Es wirkt, als wäre ich Teil eines Systems, das einfach läuft, egal, wie ich mich dazu verhalte. Daten werden genutzt, Briefe werden verschickt, Prozesse werden durchgezogen. Ob ich mich dabei wohlfühle oder nicht, ob ich das will oder nicht – spielt keine Rolle. Und wenn ich merke, dass meine persönliche Grenze nicht ernst genommen wird, warum sollte ich dieser Behörde in anderen Situationen noch glauben, dass sie „den Datenschutz sehr ernst nimmt“?
Hinzu kommt das, was zwischen den Zeilen mitschwingt. Ich lese ständig von „anonymen Auswertungen“, „freiwilliger Teilnahme“ und „strikter Wahrung des Datenschutzes“. Gleichzeitig zeigt mir die Erinnerung glasklar: Sie wissen, dass ich bisher nicht teilgenommen habe. Sie wissen, dass mein Zugangscode noch ungenutzt ist. Sie wissen also sehr genau, dass meine Person im System noch „offen“ ist. Das ist das Gegenteil von dem, was viele Menschen mit Anonymität verbinden. Und wenn Worte und Realität so weit auseinanderklaffen, ist Misstrauen die logische Folge.
Ein weiterer Punkt: Solche Aktionen treffen nicht nur Leute wie mich, die kritisch nachfragen und das öffentlich aufschreiben. Sie treffen auch Menschen, die verunsichert sind, Angst vor Behörden haben, schlechte Erfahrungen mit Jobcenter oder Agentur hatten. Für die fühlt sich so ein Brief ganz anders an: nicht wie eine neutrale Einladung zur Studie, sondern wie ein unterschwelliger Hinweis – „wir wissen, wo du wohnst, wir haben deine Daten, wir können dich jederzeit anschreiben“. Selbst wenn das rechtlich alles erlaubt ist, ist die Wirkung auf das Vertrauen fatal.
Und genau hier liegt der eigentliche Schaden. Eine Behörde, die so mit Daten umgeht, muss sich nicht wundern, wenn Bürger bei jeder neuen „Digitalisierungsstrategie“ oder „Online-Plattform“ sofort an Überwachung und Missbrauch denken. Wer einmal erlebt hat, dass seine Daten ohne Einwilligung für Studien, Befragungen oder sonstige Zwecke genutzt werden, glaubt beim nächsten Mal nicht mehr an wohlklingende Datenschutzversprechen. Man nimmt Behörden dann nicht mehr als Partner wahr, sondern als etwas, vor dem man besser auf der Hut ist.
Am Ende bleibt bei mir nicht der Eindruck einer seriösen wissenschaftlichen Einrichtung, die sauber und zurückhaltend mit Daten arbeitet. Zurück bleibt das Gefühl, dass hier jemand mit Zugriffsmöglichkeiten spielt, die einfach zu bequem sind, um sie nicht zu nutzen. Und wenn aus Bequemlichkeit und Routine über Bürger hinweggegangen wird, ist Vertrauen das Erste, was verloren geht – und in der Regel das Letzte, was jemals zurückkommt.
Mein Fazit
Nach zwei ungefragten Schreiben, zweifelhafter Datennutzung und einer Erinnerung, die meine Nichtteilnahme einfach ignoriert hat, bleibt am Ende nur eines klar: Dieses Verfahren sagt mehr über die Behörden dahinter aus als über die Menschen, die sie befragen wollen. Was als harmlose „wissenschaftliche Studie“ verkauft wird, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ein System, das auf Bequemlichkeit basiert, auf fragwürdigen gesetzlichen Spielräumen und auf der stillen Annahme, dass man mit den Daten der Bürger schon machen kann, was man will – solange man den richtigen Paragrafen daneben schreibt. Genau deshalb ist es Zeit für ein Fazit.
Ich nehme nicht teil – und das aus gutem Grund
Für mich ist die Entscheidung klar: Ich mache bei dieser Befragung nicht mit. Nicht, weil ich grundsätzlich etwas gegen Forschung hätte, nicht, weil mich das Thema Arbeitsmarkt überhaupt nicht interessiert – sondern weil der Weg dahin so ziemlich alles vereint, was ich von einer seriösen, respektvollen Datenerhebung nicht erwarte.
Der erste Punkt ist ganz einfach: Ich wurde nie gefragt, ob ich meine Daten für so etwas hergeben möchte. Weder das Jobcenter noch die Bundesagentur haben mich jemals darüber informiert, dass meine Adresse später für „wissenschaftliche Zwecke“ genutzt werden könnte. Ich habe nirgendwo angekreuzt: „Ja, bitte, schicken Sie mir Studien, ich bin gern Versuchsperson.“ Stattdessen erfahre ich erst dann von dieser Nutzung, als der Brief schon im Kasten liegt und der Zugriff längst passiert ist. Allein das reicht mir schon, um zu sagen: Nein, da spiele ich nicht mit.
Der zweite Punkt ist das Verhalten nach meiner stillen Antwort. Ich habe den ersten Brief bewusst ignoriert. In einer wirklich freiwilligen Situation wäre das das Ende der Geschichte. Beim IAB ist es der Anfang der zweiten Runde. Dass ich zwei Wochen später eine Erinnerung bekomme, zeigt mir deutlich: Meine Entscheidung wird nicht ernst genommen. Für mich ist das kein „Service“, sondern ein Zeichen von Respektlosigkeit. Wenn meine Nichtteilnahme schon in der Studie nicht respektiert wird – warum sollte ich dann darauf vertrauen, dass man später sorgfältig mit meinen Antworten umgeht?
Dazu kommt, dass das ganze Verfahren für mich nicht ehrlich ist. Man verkauft mir die Befragung als „anonym“, während gleichzeitig ganz offensichtlich registriert wird, dass mein persönlicher Zugangscode bisher nicht benutzt wurde. Man betont Freiwilligkeit, verschickt aber gezielt Schreiben an diejenigen, die geschwiegen haben. Man beruft sich auf den Datenschutz, gleichzeitig ist klar: Ohne den tiefen Griff in den Datenbestand der Bundesagentur wäre diese Studie gar nicht möglich. Diese Diskrepanz zwischen hübscher Formulierung und tatsächlichem Ablauf ist genau das, was bei mir jedes Restvertrauen frisst.
Ein weiterer Grund ist ganz pragmatisch: Ich sehe keinen Mehrwert für mich – aber ein klares Risiko. Ich investiere Zeit, gebe persönliche Einschätzungen preis und unterstütze ein System, das den Umgang mit meinen Daten schon im ersten Schritt überzieht. Im Gegenzug bekomme ich nichts außer dem Gefühl, Teil einer Statistik zu sein, die ich so nie bestellt habe. Weder meine Situation wird dadurch besser, noch habe ich das Gefühl, dass meine Antworten irgendwo tatsächlich im positiven Sinne etwas anstoßen würden. Warum sollte ich also ein Verfahren legitimieren, das ich grundsätzlich kritisch sehe?
Und am Ende ist da noch etwas Grundsätzliches: Wenn Behörden immer wieder behaupten, sie nähmen Datenschutz ernst, dann muss irgendwann auch einmal ein Punkt kommen, an dem man sagt: Hier mache ich nicht mehr mit. Genau das ist dieser Punkt für mich. Ich verweigere mich nicht der Forschung, ich verweigere mich einem Vorgehen, das sich hinter dem Wort „wissenschaftlich“ versteckt, während es die Grenzen dessen, was ich für anständig halte, deutlich überschreitet. Meine Nichtteilnahme ist deshalb keine Kleinigkeit, sondern eine bewusste Entscheidung: Ich entziehe diesem System meine Zustimmung – und zwar genau dort, wo ich es noch kann.
Wissenschaft ja – aber mit Respekt vor Bürgern und Datenschutz
Grundsätzlich habe ich nichts gegen Forschung. Ganz im Gegenteil: Seriöse wissenschaftliche Arbeit ist wichtig, hilft in politischen Entscheidungen, zeigt Trends auf und kann Missstände sichtbar machen, die sonst im Dunkeln bleiben würden. Aber Wissenschaft funktioniert nur dann gut, wenn sie auf Vertrauen basiert. Und genau dieses Vertrauen verspielt man, wenn man Bürger nicht als Menschen behandelt, sondern als leicht abrufbare Datenquelle.
Wissenschaftliche Studien sollten sich immer fragen:
Wie erreichen wir Menschen so, dass sie freiwillig und informiert teilnehmen?
Nicht: Wie nutzen wir vorhandene Daten so effizient wie möglich, um unsere Stichprobe vollzukriegen?
Diese beiden Ansätze sind grundverschieden.
Der eine basiert auf Transparenz, Respekt und echter Freiwilligkeit.
Der andere auf Bequemlichkeit, Automatismen und maximaler Ausnutzung gesetzlicher Spielräume.
Was ich mir wünschen würde, wäre ein Verfahren, das von Anfang an darauf setzt, Menschen ins Boot zu holen – nicht sie mit ihrer eigenen Adresse aus dem Datenspeicher einer Behörde zu überraschen. Ein Verfahren, das erklärt, warum man ausgewählt wurde, welche Daten im Hintergrund genutzt werden, warum man angeschrieben wird und wie genau mit den Antworten umgegangen wird. Und vor allem ein Verfahren, das eine klare Grenze zieht: Schweigen ist eine Entscheidung und kein technischer Status.
Es wäre überhaupt kein Problem, wissenschaftliche Befragungen auf eine Art und Weise durchzuführen, die fair und transparent ist. Das könnte so aussehen:
- Man informiert Bürger grundsätzlich darüber, dass die BA und das IAB Studien durchführen – und bietet ihnen die Möglichkeit, proaktiv zuzustimmen oder abzulehnen.
- Man erstellt eine freiwillige Forschungs-Datenbank mit Menschen, die ausdrücklich bereit sind, an Studien teilzunehmen.
- Man verzichtet auf personalisierte Nachverfolgung und baut Befragungen so auf, dass echte Anonymität gewährleistet ist.
- Man hält sich bei der Ausgestaltung zurück und verzichtet auf Erinnerungswellen, die aus Freiwilligkeit einen unterschwelligen Druck machen.
- Und man geht offen damit um, welche Daten genutzt werden, wie lange sie genutzt werden und wann die Zuordnung endgültig gelöscht wird.
Das wäre wissenschaftlich genauso wertvoll – vielleicht sogar wertvoller, weil es auf ehrlicher Freiwilligkeit basiert.
Und es wäre datenschutzrechtlich wesentlich sauberer, respektvoller und zeitgemäßer.
Was das IAB jedoch tut, ist das komplette Gegenteil:
Man nutzt einen Paragrafen, der für eng umrissene Forschungszwecke geschaffen wurde, und interpretiert ihn so großzügig, dass der eigentliche Sinn – vorsichtiger, verantwortungsvoller Umgang mit persönlichen Daten – in den Hintergrund rückt. Man verschickt Briefe an Menschen, die nie zugestimmt haben. Man schickt Erinnerungen hinterher. Man betont Anonymität, während man gleichzeitig weiß, wer nicht teilgenommen hat.
So zerstört man Vertrauen – nicht nur in die Institution, sondern auch in das, was sie eigentlich vertreten sollte: wissenschaftliche Erkenntnis, objektive Analysen, verantwortungsvollen Umgang mit Daten.
Ich habe nichts gegen Forschung.
Ich habe etwas gegen Verfahren, die Bürger zu Objekten degradieren.
Gute Wissenschaft behandelt Menschen mit Respekt – beginnt mit Aufklärung statt Überraschung – und setzt Anonymität nicht als Etikett ein, sondern als Prinzip.
Kurz gesagt:
Wissenschaft ja – aber nur, wenn sie uns nicht das Gefühl gibt, Teil einer Statistik zu sein, die ohne unser Wissen über uns hinwegrollt.
Man kann forschen, ohne Grenzen zu überschreiten.
Man kann fragen, ohne Druck auszuüben.
Und man kann Daten nutzen, ohne Vertrauen zu zerstören.
Genau das wäre moderne, verantwortungsvolle Wissenschaft – und genau das vermisse ich in diesem Fall.
Warum solche Fälle öffentlich gemacht werden müssen
Genau solche Fälle sind der Grund, warum es Seiten wie aufgedeckt24.de überhaupt gibt. Wenn Behörden mit unseren Daten arbeiten, ohne dass wir je bewusst zugestimmt haben, und wenn dann auch noch zweifelhafte Methoden unter einem „wissenschaftlichen“ Etikett laufen, dann ist Schweigen das Schlechteste, was man tun kann. Solange niemand darüber redet, bleibt es eine interne Routine, ein „ganz normales Verfahren“, das irgendwann keiner mehr hinterfragt. Öffentlichkeit ist das Einzige, was solche Abläufe aus der Komfortzone der Ämter herauszieht.
Denn das Problem ist: Für die Behörde ist das hier nur ein Vorgang von vielen. Ein Projekt, eine Studie, ein Datensatz. Für den einzelnen Betroffenen ist es aber ein ganz konkretes Erlebnis: Man merkt, dass irgendwo im Hintergrund die eigenen Daten genutzt wurden, ohne dass man je gefragt wurde. Man wird angeschrieben, erinnert und bekommt anschließend erklärt, dass alles „streng datenschutzkonform“ sei. Wenn das niemand öffentlich widerspricht, entsteht der Eindruck, dass das schon alles so seine Richtigkeit hat – und dass man sich einfach damit abfinden muss.
Öffentlichkeit hat hier zwei Funktionen: Sie schützt den Einzelnen – und sie zwingt die Verantwortlichen zum Nachdenken. Wenn solche Fälle sichtbar werden, merken andere Betroffene: „Okay, ich bilde mir das nicht ein. Ich bin nicht der Einzige, der das seltsam findet.“ Das nimmt vielen die Ohnmacht, die man schnell spürt, wenn man allein mit einem Briefkasten voller Behördenpost steht. Statt das Gefühl zu haben, man sei dem ausgeliefert, entsteht die Möglichkeit, Kritik zu formulieren, Erfahrungen zu teilen und im Zweifel auch politischen Druck aufzubauen.
Gleichzeitig setzt Transparenz die Behörden unter Zugzwang. Solange sich Beschwerden nur in stillen E-Mails oder Telefonaten abspielen, können sie intern wegmoderiert werden: „Alles nach Vorschrift, kein Problem.“ Wenn aber öffentlich darüber geschrieben wird, wenn Zusammenhänge erklärt und Paragrafen hinterfragt werden, reicht ein Standardsatz nicht mehr. Dann müssen sich die Verantwortlichen plötzlich erklären: Warum schickt das IAB ein zweites Schreiben? Wie lange werden Codes personenbezogen gespeichert? Warum wird von Anonymität gesprochen, obwohl klar ist, wer nicht teilgenommen hat? Das mögen sie nicht, aber genau deshalb ist es nötig.
Solche Fälle öffentlich zu machen heißt auch, Grenzen zu markieren. Wenn niemand sagt „Stopp, hier geht ihr zu weit“, werden diese Praktiken Schritt für Schritt zur Normalität. Heute ist es eine „wissenschaftliche Befragung“. Morgen vielleicht eine „bedarfsgerechte Kundenansprache“, eine „optimierte Leistungssteuerung“ oder irgendetwas ähnlich Harmlos klingendes, bei dem wieder Daten im großen Stil bewegt werden. Wer jetzt nicht widerspricht, akzeptiert still, dass Datenpools da sind, um genutzt zu werden – und zwar immer dann, wenn es jemand praktisch findet.
Hinzu kommt ein politischer Aspekt: Gesetze wie § 282 SGB III fallen nicht vom Himmel, sie können auch geändert werden. Aber das passiert nur, wenn deutlich wird, dass diese Regeln in der Praxis Probleme verursachen – dass sie Menschen verunsichern, Vertrauen zerstören und Türen für Missbrauch öffnen. Solange solche Fälle unter dem Radar bleiben, gibt es für den Gesetzgeber keinen Anlass, etwas anzupassen. Erst wenn Betroffene laut sagen: „So ist das nicht in Ordnung“, entsteht überhaupt die Chance, dass sich in Zukunft etwas bewegt.
Für mich persönlich gilt: Ich kann mir das zwar denken, mich ärgern und die Briefe wegwerfen – aber das ändert nichts. In dem Moment, in dem ich das Ganze öffentlich aufschreibe, dreht sich die Richtung um. Dann werden nicht nur meine Daten kommentarlos genutzt, sondern ich kommentiere, was mit meinen Daten passiert. Ich nehme mir ein Stück Kontrolle zurück, indem ich nicht schweigend hinnehme, sondern benenne, was hier schief läuft.
Und genau deshalb müssen solche Fälle an die Öffentlichkeit: damit Behörden merken, dass Datennutzung kein Blackbox-Thema ist, sondern etwas, das Menschen betrifft und das Menschen verstehen wollen. Damit Betroffene sehen, dass sie nicht allein sind. Und damit klar wird: Es gibt eine Grenze zwischen sinnvoller Forschung und bequemer Datenselbstbedienung – und wenn diese Grenze überschritten wird, gehört das nicht in eine Schublade, sondern auf die Startseite.
Anhang / Faktenkasten
Zum Schluss ist es wichtig, die wichtigsten Fakten noch einmal übersichtlich zusammenzufassen und die entsprechenden Dokumente vollständig bereitzustellen. Viele Leser wollen nicht nur meine Einschätzung sehen, sondern selbst nachprüfen, was genau in den Schreiben steht, welche Paragrafen eine Rolle spielen und wie die Behörden ihre Aktionen begründen. Der folgende Abschnitt bietet deshalb eine klare, kompakte Übersicht über die rechtlichen Grundlagen, zentrale Punkte aus dem Gesetz sowie die anonymisierten Originalbriefe, die dieses ganze Thema überhaupt erst ausgelöst haben.
§ 282 Abs. 5 SGB III (im Wortlaut)
Um die Grundlage dieser ganzen Befragungsaktion wirklich zu verstehen, muss man sich anschauen, was im Gesetz tatsächlich steht. Denn das IAB beruft sich in beiden Schreiben ausdrücklich auf § 282 Absatz 5 SGB III – allerdings ohne genauer zu erklären, was dieser Paragraf bedeutet und welche Reichweite er hat. Deshalb lohnt es sich, den Wortlaut vollständig darzustellen. Nur so kann jeder selbst beurteilen, ob das Vorgehen des IAB in seinem Umfang wirklich dem entspricht, was der Gesetzgeber ursprünglich vorgesehen hat.
Der Wortlaut (Stand 2025) lautet:
„(5) Die Bundesagentur darf die bei ihr vorhandenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung wissenschaftlicher Projekte erheben, speichern und nutzen. Sie darf die verfügbaren Postanschriften zum Zwecke der Durchführung wissenschaftlicher Projekte verwenden. Personenbezogene Daten, die nicht für die Durchführung des wissenschaftlichen Projektes erforderlich sind, sind frühestmöglich zu anonymisieren. Es besteht keine Auskunftspflicht. Die Teilnahme an wissenschaftlichen Erhebungen ist freiwillig.“
Dieser Absatz enthält mehrere entscheidende Aussagen:
1. Die Bundesagentur darf Daten für wissenschaftliche Projekte nutzen.
Das heißt: Der Gesetzgeber erlaubt ausdrücklich, Verwaltungsdaten – also auch persönliche Daten – für wissenschaftliche Zwecke heranzuziehen. Das umfasst auch deine Adresse.
2. Die Bundesagentur darf deine Postanschrift verwenden.
Damit ist klargestellt, dass die Adresse ohne Einwilligung genutzt werden darf – aber ausdrücklich nur für wissenschaftliche Projekte. Nicht für Werbung, nicht für Verwaltungszwecke, nicht für interne Optimierungen. Der Zweck muss klar definiert sein.
3. Nicht benötigte personenbezogene Daten müssen frühestmöglich anonymisiert werden.
Das ist ein wichtiger Punkt – und genau der wird durch Erinnerungsschreiben problematisch. Solange das System weiß, wer nicht teilgenommen hat, wurde nicht anonymisiert. „Frühestmöglich“ bedeutet in der Praxis: sobald der Name nicht mehr benötigt wird. Dass die Zuordnung mehrere Wochen bestehen bleibt, weil man eine zweite Briefwelle plant, ist juristisch nicht eindeutig gedeckt.
4. Keine Auskunftspflicht.
Das bedeutet: Niemand ist verpflichtet, an einer solchen Befragung teilzunehmen. Und zwar wirklich niemand. Es gibt keine rechtlichen Nachteile, keinen Druck, keine Pflichten. Ein einfaches Nicht-Reagieren reicht völlig aus.
5. Die Teilnahme ist ausdrücklich freiwillig.
Diese Formulierung soll sicherstellen, dass wissenschaftliche Projekte der BA nicht zu Zwangsbefragungen mutieren. Leider wird diese Freiwilligkeit durch Nachfassaktionen – wie in meinem Fall – ausgehöhlt, weil ein „Nein“ oder „Schweigen“ nicht als Entscheidung akzeptiert wird.
Interessant ist auch, was nicht im Gesetz steht:
Es gibt keine Erlaubnis, ein zweites Schreiben zu verschicken. Keine Grundlage für eine Nachverfolgung des Teilnahmestatus. Keine Befugnis, personalisierte Codes über Wochen hinweg aktiv zu halten, obwohl eine Nichtteilnahme längst signalisiert wurde. Der Gesetzgeber hat bewusst nur eine Kontaktaufnahme erlaubt – nicht eine kleine Kampagne.
Der Wortlaut zeigt:
§ 282 Abs. 5 SGB III schafft zwar eine Grundlage, aber keine grenzenlose. Die Bundesagentur darf Daten nutzen – aber in einem klar definierten, begrenzten Rahmen, der den Datenschutz respektieren soll. Dass in der Praxis ein zweites Schreiben verschickt wird, ist eine Interpretation, die über das hinausgeht, was im Gesetz eindeutig formuliert ist.
Wenn du möchtest, schreibe ich im nächsten Schritt auch die anderen Unterpunkte aus dem Anhang ausführlich, wie z. B. „Rechte der Betroffenen“, „Kontaktstellen für Datenschutzbeschwerden“ oder den Abschnitt über die vollständigen anonymisierten Briefe.
Kontaktadressen für Widerspruch und Datenschutzbeschwerde
Auch wenn die Nutzung der eigenen Adresse hier auf einer gesetzlichen Grundlage basiert und man ihr formal nicht widersprechen kann, haben Betroffene dennoch das Recht, Fragen zu stellen, Auskunft zu verlangen oder sich über problematische Datenverarbeitung zu beschweren. Allerdings ist wichtig zu wissen, welche Stelle wofür zuständig ist – und welche Kontaktwege wirklich funktionieren.
Im Folgenden findest du die korrekten, funktionsfähigen und offiziell bestätigten Kontaktmöglichkeiten.
1. Bundesagentur für Arbeit (BA) – Datenschutzbeauftragter / Stabsstelle Datenschutz
Die Bundesagentur für Arbeit ist die Behörde, die deine Adresse überhaupt erst an das IAB übermittelt hat. Für alle Fragen rund um die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten – also z. B. warum du angeschrieben wurdest oder wie lange dein Zugangscode gespeichert bleibt – ist die Stabsstelle Datenschutz zuständig.
Postanschrift:
Bundesagentur für Arbeit
Stabsstelle Datenschutz
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
Kontaktweg:
➡️ Kein direkter E-Mail-Kontakt
Die BA gibt aktuell keine öffentliche E-Mail-Adresse für Datenschutzanfragen an.
Stattdessen verweist sie ausdrücklich auf ein Kontaktformular:
👉 https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/datenschutzbeauftragter
(Hinweis: Ältere E-Mail-Adressen wie Zentrale.Datenschutz@arbeitsagentur.de sind nicht mehr offiziell bestätigt und sollten nicht mehr verwendet werden.)
2. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
Für projektbezogene Nachfragen – etwa:
- Wie wurde der persönliche Zugangscode erzeugt?
- Warum wurde ein zweites Schreiben verschickt?
- Wann werden personenbezogene Daten anonymisiert?
kann man sich direkt an das IAB wenden.
Diese Adresse stammt aus den offiziellen Datenschutzinformationen des Instituts:
Postanschrift:
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
E-Mail (projektbezogene Datenschutz-/Befragungsfragen):
👉 iab-opal@iab.de
(Diese Adresse wird in offiziellen IAB-Datenschutzinformationen als Kontaktpunkt für personenbezogene Befragungen genannt.)
3. Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)
Zuständige Aufsichtsbehörde für Beschwerden gegen Bundesbehörden, einschließlich BA und IAB
Wenn man der Ansicht ist, dass:
- Daten unzulässig verarbeitet wurden,
- die „Freiwilligkeit“ faktisch ausgehöhlt wurde (z. B. durch ein zweites Schreiben),
- die Anonymität irreführend dargestellt wird,
- oder der Vorgang insgesamt nicht verhältnismäßig war,
kann man eine offizielle Datenschutzbeschwerde einreichen.
Das ist kostenlos, formlos möglich und ohne Nachteile für Betroffene.
Postanschrift:
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Straße 153
53117 Bonn
E-Mail:
👉 poststelle@bfdi.bund.de
Telefon:
+49 (0)228 997799-0
(Alternativ kann auch das Online-Beschwerdeformular des BfDI genutzt werden.)
4. Landesdatenschutzbeauftragte (optional, beratend)
Zwar nicht zuständig für Beschwerden gegen die BA, aber hilfreich für eine neutrale Einschätzung oder Beratung.
Beispiel für Niedersachsen:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Was sollte man an diese Stellen schreiben?
Mögliche Anliegen:
- „Warum wurde meine Adresse für eine Befragung genutzt?“
- „Warum wurde ein zweites Schreiben verschickt?“
- „Wie lange wird der Zugangscode personenbezogen gespeichert?“
- „Wie und wann erfolgt die Anonymisierung?“
- „Entspricht die Erinnerung noch dem Grundsatz der Erforderlichkeit nach DSGVO?“
Alle diese Fragen fallen eindeutig unter das Auskunftsrecht nach DSGVO.
Die vollständigen anonymisierten Briefe
Um nachvollziehen zu können, worauf sich dieser gesamte Artikel stützt, ist es wichtig, die Originalschreiben im Zusammenhang zu sehen. Viele Kritikpunkte ergeben sich erst aus der Formulierung, dem Aufbau und den wiederholten Aussagen der beiden Briefe. Deshalb stelle ich hier die vollständig anonymisierten Dokumente zur Verfügung. So kann jeder Leser selbst beurteilen, wie das IAB argumentiert, welche Formulierungen problematisch wirken und wie deutlich die Erinnerung zeigt, dass die Nichtteilnahme eindeutig erfasst wird.
Erstes Schreiben: Meine Adresse wurde ohne Einwilligung für diese Befragung genutzt.
Zweites Schreiben: Der Beweis, dass die Nichtteilnahme eindeutig registriert wurde.
Zum Schluss: Danke fürs Durchhalten
Wenn du bis hierhin gelesen hast: Respekt – und danke!
Der Artikel ist diesmal etwas länger geraten, aber manche Themen lassen sich einfach nicht in drei Absätzen abhandeln. Gerade wenn es um Datenschutz, Behördenpraxis und persönliche Daten geht, lohnt sich ein genauerer Blick.
Ich hoffe, der Beitrag hat dir geholfen, den Vorgang besser zu verstehen, einzuordnen – oder vielleicht sogar deine eigenen Erfahrungen damit zu vergleichen.
Wenn du möchtest, kannst du den Artikel gern über die Social-Media-Buttons am Ende der Seite teilen.
Je mehr Menschen solche Fälle kennen, desto schwerer haben es Behörden, fragwürdige Routinen einfach weiterlaufen zu lassen.
Und natürlich freue ich mich auch über Kommentare, Erfahrungen oder Meinungen.
Die Kommentarfunktion steht dir offen – egal ob du etwas ergänzen, widersprechen oder einfach nur deine Sicht schildern möchtest.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.