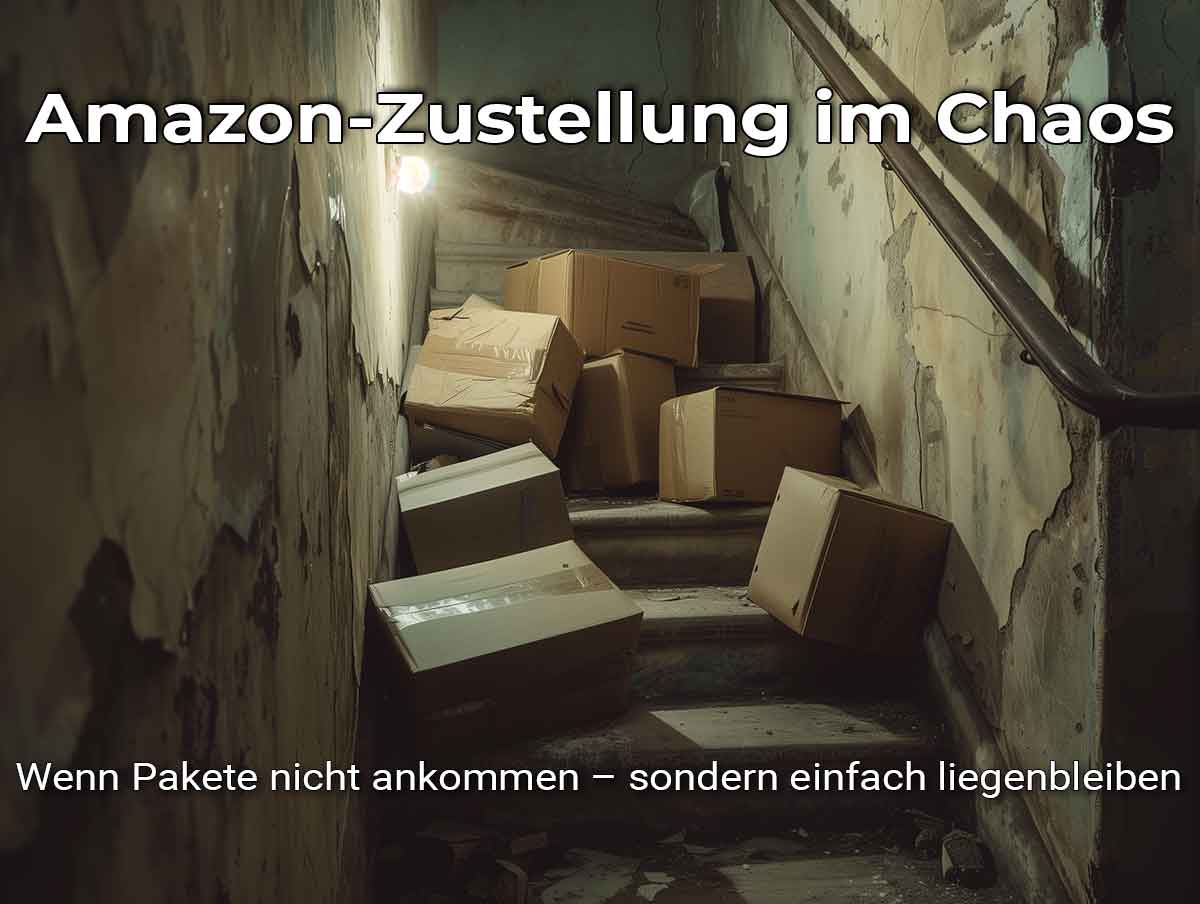
Paketzustellung in Deutschland ist längst zum Glücksspiel geworden. Mal landet die Sendung vor der Haustür, mal bei einem „Hausbewohner“, den niemand kennt – und oft verschwindet sie ganz. Amazon und andere Paketdienste reden sich heraus, während Kunden mit Fotos fremder Fußmatten oder nichtssagenden Statusmeldungen abgespeist werden. In meinem Artikel zeige ich dir, warum das System so chaotisch ist, welche rechtlichen Fakten wirklich zählen – und weshalb eine Petition endlich Veränderung bringen soll.
Einleitung: Pakete im Nirwana
Kennst du das? Die App jubelt „Zugestellt“, aber bei dir ist nichts angekommen. Kein Hinweis im Briefkasten, kein Paket beim Nachbarn, keine Quittung. Stattdessen zeigt dir die Sendungsverfolgung irgendein Paket auf irgendeiner Fußmatte – nur nicht auf deiner. Willkommen im Jahr 2025, in dem Pakete öfter im Nirwana landen als in deiner Hand. Und ja, wir reden vor allem über Amazon, aber nicht nur. Das Zustellproblem ist ein Systemfehler – und der Kunde ist der, der ihn ausbaden darf.
Seit Corona hat sich ein stiller Standard eingeschlichen: keine Unterschrift, keine echte Übergabe, dafür ein „Beweisfoto“ und eine Statusmeldung, die alles und nichts bedeuten kann. Früher war die Sache simpel: Jemand unterschreibt – oder eben nicht. Heute tippt der Fahrer selbst „zugestellt“ ins Gerät und ist damit raus. Für dich beginnt dann die Schnitzeljagd: Nachbarn abklappern, Einfahrt absuchen, Hausflur scannen, Support suchen. Zeitaufwand: deiner. Verantwortung: angeblich nicht mehr deren.
Besonders absurd wird es, wenn Amazon parallel schon nach einer Bewertung fragt. „Wie war die Zustellung?“ – mit Daumen hoch oder runter, hübsch gamifiziert. Klickst du auf „war nicht so toll“ und wählst „Ich habe das Paket nicht erhalten“, bekommst du einen höflichen „Schade“-Text. Hilfe? Fehlanzeige. Stattdessen sollst du dich selbst zum Support durchklicken, irgendwo tief im Menü, das Google schneller findet als die eigene Website. Das ist kein Service, das ist Schadensbegrenzung mit UI-Glanz.
Die Ursachen sind bekannt und werden genauso reflexartig wiederholt: Subunternehmer, Zeitdruck, schlechte Bezahlung, viele Stopps. Alles richtig – aber nichts davon rechtfertigt, dass Pakete vor Haustüren abgeladen, Fantasie-Statusmeldungen gesetzt oder Kunden abgewimmelt werden. Wenn ein System nur funktioniert, solange niemand es ernst nimmt, ist nicht der Kunde das Problem, sondern das System.
Besonders deutlicher wird die Schieflage, wenn plötzlich doch Sicherheit zählt: Bei teureren Artikeln gibt’s auf einmal Einmalpasswörter, strengere Übergaben und Zusteller, die sich an Regeln erinnern. Offenbar weiß man ganz genau, dass das normale Verfahren unsicher ist – man nimmt es nur in Kauf, solange es „billig und schnell“ bleibt. Für Kleinkram reicht ein Foto, für teure Ware plötzlich formelle Übergabe. Praktisch. Für dich: inkonsequent.
Das Traurige: Händler zahlen am Ende mit, weil sie erstatten oder neu versenden müssen. Ehrliche Zusteller zahlen mit ihrem Ruf. Und du zahlst vor allem mit Zeit und Nerven. Der einzige, der kaum leidet, ist der Konzern, der das Risiko schlicht eingepreist hat. Ersetzen ist günstiger, als Ursachen zu beheben. Solange genug Leute stillhalten, bleibt alles wie es ist.
Dieser Artikel räumt auf: mit den gängigen Ausreden, mit der Bewertungs-Attrappe, mit dem Versteckspiel beim Support – und mit der Mär, das sei alles „alternativlos“. Ich zeige dir, warum ordentliche Zustellung keine Raketenwissenschaft ist, wie andere Dienste es zumindest teilweise besser machen und wo die Stellschrauben wirklich sitzen: beim Gesetzgeber und der Bundesnetzagentur. Denn wenn freiwillig nichts passiert, braucht es klare Pflichten, echte Nachweise und spürbare Sanktionen.
Und weil Meckern allein nichts ändert, folgt weiter unten eine Petition an den Bundestag. Kurz, klar, umsetzbar – damit Zustellung wieder bedeutet, was das Wort verspricht: Paket in deine Hand, nicht ein Bild von irgendeiner Fußmatte.
Unterstütze jetzt die Petition beim Deutschen Bundestag!
Damit sich endlich etwas ändert, brauche ich deine Stimme:
Petition 185319 – Zustellbedingungen für Paketdienste verschärfen
Das Zustellchaos bei Amazon
Wenn es um Zustellchaos geht, spielt Amazon in der ersten Liga. „Zugestellt“ bedeutet dort schon lange nicht mehr, dass du dein Paket auch tatsächlich in den Händen hältst. Im besten Fall findest du es irgendwann zufällig vor deiner Tür, frei zugänglich für jeden, der schneller greift als du. Im schlechteren Fall bleibt es spurlos verschwunden – während die App fröhlich meldet: „Alles erledigt, Kunde glücklich.“
Früher war das noch anders. Da musste der Zusteller deine Unterschrift einholen, und im Sendungsstatus stand sauber: „Zugestellt an Hausbewohner: Mustermann.“ Das war immerhin nachvollziehbar. Während Corona änderte sich das: Plötzlich gab es die Unterscheidung zwischen „Übergeben an Original-Empfänger“ oder „Übergeben an Hausbewohner“. Nicht perfekt, aber wenigstens noch ein kleiner Hinweis, wer angeblich das Paket in Empfang genommen hatte.
Heute sind wir an einem Punkt angekommen, an dem alle Unterschiede beseitigt wurden. Ob du das Paket persönlich angenommen hast, dein Nachbar oder es einfach irgendwo abgestellt wurde – der Status lautet schlicht: „Zugestellt“ und klein darunter „An Hausbewohner übergeben.“ Punkt. Keine Namen, keine Klarheit, keine Verantwortung. Jeder ist Hausbewohner – sogar der Fahrer selbst, wenn er es darauf anlegt.
Dazu kommt die mittlerweile berüchtigte Foto-Methode. Statt einer Unterschrift bekommst du ein Bild von irgendeinem Paket auf irgendeiner Fußmatte in irgendeinem Treppenhaus. Ob das wirklich deine Sendung ist, erkennst du nicht – der Adressaufkleber bleibt schön außerhalb des Bildes. Für Amazon gilt das trotzdem als wasserdichter Zustellnachweis. Für dich bleibt die Frage: Wo liegt mein Paket eigentlich wirklich?
Noch absurder wird es, wenn gar kein Nachweis existiert. Dann ploppt einfach nur der Status „Zugestellt“ auf, ohne Foto, ohne Name, ohne irgendwas. Klingeln? Fehlanzeige. Ein echter Zustellversuch? Zu viel Aufwand. Das Prinzip dahinter wirkt simpel: Paket abladen, Haken setzen, weiterfahren. Ob du die Lieferung jemals siehst, ist nebensächlich.
Und was passiert, wenn du den Support kontaktierst? Erstmal abwarten. Zwei Tage vielleicht, manchmal länger – vielleicht taucht es ja doch noch auf. Vielleicht hat ein Nachbar es, vielleicht stellt der Fahrer es später noch irgendwo ab. Wenn nicht, bekommst du Ersatz oder dein Geld zurück. Klingt kulant, ist aber nichts anderes, als das eigentliche Problem unter den Teppich zu kehren.
Denn wirklich gelöst wird dabei nichts. Weder die Frage, warum Zusteller Pakete verschwinden lassen, noch, warum falsche Zustellvermerke oder Türfotos ohne Adresse als Beweis gelten. Für dich bedeutet das Ärger, Zeitverlust und Unsicherheit. Für Amazon ist es eine reine Kostenrechnung: Ein paar tausend Ersatzlieferungen im Monat fallen im Milliardenumsatz kaum auf – solange die Zustellung billig bleibt.
Unterm Strich heißt das: Eine ordnungsgemäße Übergabe ist bei Amazon längst nicht mehr der Standard, sondern fast schon die Ausnahme. Mit der Ersatz-oder-Erstattung-Strategie kauft sich der Konzern von echter Verantwortung frei. Für dich bleibt: Pakete bestellen ist wie Lotto spielen. Manchmal klappt es, manchmal landet die Lieferung im Nirgendwo – offiziell gilt sie aber immer als „zugestellt“.
Wenn das Paket verschwindet
„Zugestellt“ sagt die App. „Hier ist nichts“ sagst du. Ab hier schickt dich Amazon erst mal auf Schnitzeljagd. Die offizielle Hilfe liest sich, als hättest du dein Paket bloß verlegt: Adresse noch mal prüfen (vielleicht hast du aus Versehen woanders gewohnt?), ins Message-Center schauen, den Briefkasten kontrollieren, den Ablageort inspizieren, Nachbarn und Mitbewohner befragen. Und dann bitte 48 Stunden warten – Pakete könnten „vorab als zugestellt gescannt worden sein“. Sprich: Erst wird abgehakt, dann vielleicht irgendwann geliefert. Komfortabel – allerdings nur für Amazon.
Das Muster dahinter ist immer gleich: Bevor irgendwer bei Amazon Verantwortung übernimmt, sollst du erst mal alles Mögliche ausschließen. Du wirst zum Ermittler deiner eigenen Bestellung. Du suchst im Hausflur, unter der Fußmatte, hinter dem Blumentopf, fragst drei Etagen ab, ob ein „Hausbewohner“ deine Sendung gesehen hat. Was im System als „Service“ verkauft wird, ist in der Praxis das Auslagern der Arbeit an den Kunden.
Besonders bizarr wird es mit den Zustellfotos. Statt einer Unterschrift bekommst du ein Bild von irgendeinem Paket auf irgendeiner Fußmatte in irgendeinem Treppenhaus. Der Adressaufkleber? Praktischerweise nicht im Bild. Ob es dein Paket ist, erkennst du nicht – aber als „Nachweis“ reicht es trotzdem. Wenn du Glück hast, findest du die gezeigte Stelle. Wenn du Pech hast, ist das Foto schlicht wertlos. Und ja: Es gibt Fälle, in denen Fahrer ein Foto machen und das Paket danach wieder mitnehmen. Genau das hat mir eine Amazon-Mitarbeiterin am Telefon wörtlich bestätigt: „Das passiert öfter.“ Das ist kein Ausrutscher, das ist gelebter Alltag.
Was folgt, wenn die Suche erwartbar ergebnislos bleibt? Zuerst die Beruhigungspille: „Bitte noch etwas Geduld.“ Vielleicht taucht das Paket ja wie durch Zauberhand auf – plötzlich, unerwartet, irgendwann. Falls nicht, beginnt die nächste Schleife. Ist es ein Marketplace-Artikel, sollst du dich zuerst beim Verkäufer melden. Nur wenn Amazon selbst versendet hat, darfst du direkt zum Kundenservice. Und selbst dort merkst du schnell: Der Prozess ist darauf optimiert, den Fall möglichst spät zu übernehmen. Ersatz oder Erstattung gibt es am Ende meist – aber erst, nachdem du genug Zeit investiert hast, das Problem „bei dir“ zu suchen.
Das eigentlich Traurige: Diese ganze Mechanik funktioniert, weil seit Corona der verbindliche Zustellnachweis praktisch abgeschafft wurde. Früher gab es eine Unterschrift, notfalls mit Namen im Status („Zugestellt an Hausbewohner: Mustermann“). Während Corona wurde immerhin noch zwischen „Original-Empfänger“ und „Hausbewohner“ unterschieden. Heute bist du nur noch ein „Hausbewohner“ – selbst dann, wenn du das Paket persönlich annimmst. Transparenz: null. Nachvollziehbarkeit: null. Verantwortung: delegiert.
Und genau so liest sich auch die Hilfeseite: nicht wie Hilfe, sondern wie ein Katalog an Pflichten für dich. Prüfen, suchen, warten, herumtelefonieren. Der Clou: Solange die Bestellung im System als „zugestellt“ markiert ist, laufen in Amazons Welt schon die Folgeprozesse – etwa Bewertungs-Mails („Wie war die Lieferung?“), als sei alles glatt gelaufen. Dein „Ich habe nichts erhalten“ landet derweil in einer Klickstrecke, die dich nicht zur Lösung, sondern erst mal zu einem „Schade“-Text führt. Hilfe gibt’s – nach mehreren weiteren Klicks.
Die Wahrheit ist unbequem, aber simpel: Amazon hat das Risiko eingepreist. Ein paar tausend Ersatzlieferungen im Monat sind billiger als eine Zustellorganisation, die konsequent klingelt, übergibt, dokumentiert und haftet. Die Hilfeseite, die 48-Stunden-Regel, die Foto-„Nachweise“, die Verweisung an den Marketplace-Händler – all das sorgt vor allem dafür, dass Zeit vergeht und Kosten dort bleiben, wo sie Amazon am wenigsten wehtun: bei dir (Zeit/Nerven) und beim Händler (Umsatz/Erstattung).
Unterm Strich: Wenn dein Paket „verschwindet“, ist das kein kurioser Einzelfall, sondern ein systemischer Effekt. Das Foto auf irgendeiner Fußmatte ersetzt keinen Beleg. Der Status „Zugestellt“ ersetzt keine Übergabe. Und eine Hotline-Aussage wie „Das passiert öfter“ ist kein Ausrutscher, sondern die ehrlichste Bestandsaufnahme, die du von Amazon bekommst.
Rechtlich gesehen: „Zugestellt“ ist nicht gleich zugestellt
Amazon liebt grüne Häkchen. Juristisch zählen aber keine Häkchen, sondern Übergaben. Im deutschen Kaufrecht ist das schlicht geregelt: Bei einem Verbrauchsgüterkauf – also du als Verbraucher, der Händler als Unternehmer – trägt der Verkäufer das Risiko bis zu dem Moment, in dem die Ware dir tatsächlich übergeben ist. Das ist die Grundlinie von § 446 BGB („Gefahrübergang bei Übergabe“) in Verbindung mit den Schutzvorschriften der §§ 474 ff. BGB. „Zugestellt“ in der App ist deshalb kein rechtlicher Endpunkt, solange du die Sendung nicht in der Hand hattest. Ein Scan, ein Fahrer-Tap auf dem Handgerät oder ein Foto von „irgendeinem Paket auf irgendeiner Fußmatte“ ersetzt die Übergabe nicht.
Genau an dieser Stelle wird oft mit dem Versendungskauf argumentiert: § 447 BGB sagt, grob vereinfacht, dass beim Versand die Gefahr schon mit der Auslieferung an den Transporteur auf den Käufer übergeht. Klingt erst mal nach „Paket raus = Risiko bei dir“. Für Verbraucher im Onlinehandel stimmt das aber regelmäßig nicht. Denn § 447 BGB wird durch § 475 BGB zugunsten von Verbrauchern zurückgedrängt: Nur wenn du selbst den Frachtführer ausgewählt hast und der Unternehmer ihn nicht vorgegeben oder benannt hat, geht das Risiko so früh auf dich über. Im Alltag wählt fast immer der Verkäufer bzw. die Plattform den Dienstleister – damit bleibt das Risiko bis zur tatsächlichen Übergabe an dich beim Verkäufer. Kurz: Der Standardfall im Onlinehandel ist nicht § 447, sondern § 446 BGB.
Was zählt als „Übergabe“? Juristisch gesprochen: Besitzverschaffung an dich (§ 433 Abs. 1 Satz 1 BGB). Praktisch heißt das, die Ware muss dir übergeben werden oder einer Person oder einem Ort, den du dafür ausdrücklich autorisiert hast. Wenn du eine Abstellgenehmigung erteilst („bitte im Carport hinterlegen“), ist die Ablage dort Lieferung – weil du sie vorher erlaubt hast. Ohne eine solche Genehmigung ist das bloße Vor-die-Tür-Stellen keine ordnungsgemäße Erfüllung. Ähnlich bei Nachbarschaftszustellung: Paketdienste kennen in ihren AGB Ersatzzustellungen, aber für die Erfüllung deiner Kaufvertragsrechte genügt nicht, dass irgendwo im Hausflur ein „Hausbewohner“ behauptet wird. Entscheidend ist, dass die Übergabe nachvollziehbar ist und du anschließend Besitz erlangst. Ein Status „An Hausbewohner übergeben“ ohne Namen, ohne Benachrichtigung und ohne erkennbaren Bezug ist ein dünner Nachweis – und das geht nicht zu deinen Lasten, sondern zu Lasten des Verkäufers.
Bei Amazon kommt eine zweite Ebene dazu: Wer ist dein Vertragspartner und wer haftet für wen? Kaufst du „Verkauf und Versand durch Amazon“, bist du im Vertrag mit Amazon (§ 433 BGB). Geht etwas schief, muss Amazon liefern – fertig. Kaufst du bei einem Marketplace-Händler, der „Versand durch Amazon“ (FBA/Prime) nutzt, bleibt rechtlich der Händler dein Verkäufer. Amazon erledigt aber Lagerung und Zustellung – rechtlich als Erfüllungsgehilfe des Händlers (§ 278 BGB). Für Fehler des Erfüllungsgehilfen haftet der Verkäufer, als wären es seine eigenen. Für dich macht das einen wichtigen Unterschied in der Praxis: Du musst dich nicht in ein Ping-Pong zwischen Händler und Logistiker drängen lassen. Der Verkäufer schuldet die ordnungsgemäße Lieferung – und wenn Amazon die Logistik führt, liegt der Ball faktisch und organisatorisch bei Amazon.
Das ewige Thema Beweis wird gerne künstlich vernebelt. Ein Tracking-Eintrag „Zugestellt“ ist kein harter Erfüllungsnachweis. Ein Foto kann ein Indiz sein – aber eben nur dann, wenn es die konkrete Übergabesituation so dokumentiert, dass sie dir zugeordnet werden kann. Ein Bild ohne Adresse, ohne Adressaufkleber, ohne erkennbare Zuordnung ist als „Beweis“ kaum belastbar. Früher half die Unterschrift (teilweise sogar namentlich: „Zugestellt an …“). Während der Corona-Zeit tauchten Formulierungen wie „Übergeben an Original-Empfänger“ oder „… an Hausbewohner“ auf. Inzwischen verschwindet oft sogar diese Differenzierung, und jeder ist nur noch ein „Hausbewohner“. Das mag für die Statistik praktisch sein; für die Beweisführung des Verkäufers ist es schwach. Und wichtig: Die Beweislast für die ordnungsgemäße Erfüllung trägt nicht der Kunde, sondern am Ende der Verkäufer – der behauptet ja, korrekt geliefert zu haben.
Was sind deine Rechte, wenn nichts ankommt? Zunächst schuldet der Verkäufer Erfüllung – also Lieferung (§ 433 BGB). Bleibt die Ware aus oder wurde „zugestellt“, ohne dass du etwas bekommen hast, hast du die Nacherfüllung zu Gute, typischerweise in Form einer Ersatzlieferung (§ 439 BGB). Passiert auch nach einer angemessenen Nachfrist nichts, kannst du vom Vertrag zurücktreten und den Kaufpreis zurückverlangen (§§ 437 Nr. 2, 323, 346 BGB). Sind dir durch die Nichtlieferung Schäden entstanden (z. B. nachweisbare Mehrkosten durch Ersatzbeschaffung), kommt Schadensersatz in Betracht (§ 280 BGB). Auf europäischer Ebene schreibt die Verbraucherrechte-Richtlinie zusätzlich vor, dass der Unternehmer im Regelfall spätestens binnen 30 Tagen liefern muss; überschreitet er das und reagiert auch auf eine Nachfrist nicht, darfst du zurücktreten – das ist kein „Goodwill“, sondern geltendes Recht.
Und all die netten Hinweise aus der „offiziellen Hilfe“ – „Adresse prüfen, Nachbarn fragen, 48 Stunden warten, Transportunternehmen kontaktieren“ – klingen aktivierend, sind rechtlich aber kein Pflichtprogramm für dich. Natürlich darfst du aus Pragmatismus beim Nachbarn klingeln oder mal im Hausflur schauen. Müssen tust du das nicht. Dein Job ist schlicht, dem Verkäufer mitzuteilen: „Ware nicht erhalten.“ Alles Weitere ist seine Sache. Wenn Amazon – ob als Verkäufer oder als Logistiker für den Händler – behauptet, ordnungsgemäß zugestellt zu haben, müssen sie das belegen. Ein App-Status ohne greifbaren Übergabenachweis reicht dafür nicht.
Übrig bleibt ein einfacher Merksatz, den du dir in die Bookmarks legen kannst: Solange du die Ware nicht tatsächlich hast, ist sie rechtlich nicht geliefert. § 446 BGB schützt dich genau davor, dass „zugestellt“ zu einem Zauberwort wird. § 475 BGB verhindert, dass man dir § 447 BGB unterjubelt, obwohl du dir den Zusteller gar nicht ausgesucht hast. § 278 BGB sorgt dafür, dass der Verkäufer sich nicht hinter Subunternehmern verstecken kann. Und § 439, § 437, § 323, § 280 BGB geben dir den Werkzeugkasten in die Hand: Ersatzlieferung, Rücktritt, Rückzahlung, Schadensersatz – nicht aus Kulanz, sondern weil das Gesetz es so will.
Wenn dir also wieder jemand erklärt, du sollst erst einmal „48 Stunden abwarten“ oder dich „bitte an den Transporteur wenden“, kannst du gelassen bleiben. Dein Vertrag besteht mit dem Verkäufer – bei „Verkauf und Versand durch Amazon“ eben mit Amazon. Er muss liefern, er muss nachweisen, er muss ersetzen oder erstatten. Das grüne Häkchen mag für Amazons KPI schön sein. Für dein Recht auf Lieferung zählt nur, was am Ende zählt: Paket in deiner Hand.
Wenn billig wichtiger ist als zuverlässig
Die Wahrheit ist unbequem: In der Zustelllogik von Amazon & Co. zählt zuerst der Preis pro Paket – und erst weit dahinter die Frage, ob du die Sendung am Ende wirklich in der Hand hältst. Das ist kein Ausrutscher, sondern das Design. Die letzte Meile ist die teuerste Meile; also wird sie auf Biegen und Brechen „billig“ gemacht. Das Rezept ist simpel: Subunternehmer statt eigener Mitarbeiter, Touren, die auf dem Papier funktionieren, in der Realität aber nur mit Abkürzungen und Augen-zu-und-durch. Am Ende steht ein KPI: raus mit dem Paket, Haken setzen, nächste Adresse. Ob dazwischen eine ordentliche Übergabe stattfindet, ist zweitrangig – solange der Scanner „zugestellt“ meldet.
Dieses System produziert genau die Phänomene, die du täglich siehst. Fahrer, die nicht klingeln, weil eine halbe Minute Wartezeit den Schnitt ruiniert. Ablage vor der Tür, weil die Tour noch 120 Stopps hat. Fantasie-Vermerke wie „Hausbewohner“ oder „Gefahr durch Hunde“, weil sie schneller sind als ein ernsthafter Zustellversuch. Und wenn es schiefgeht, greift die Standardformel: „Bitte 48 Stunden warten, vielleicht taucht es noch auf.“ Das ist kein Service, das ist Zeitgewinn – Zeit, die in keiner Kostenstelle auftaucht, weil sie auf dich ausgelagert wird.
Billig heißt hier nicht nur niedriger Lohn. Billig heißt vor allem, dass die Fehlerquote eingepreist ist. Ein Teil der Pakete verschwindet? Dann eben Ersatz oder Erstattung. Das ist in der Gesamtrechnung günstiger, als flächendeckend genügend Personal auszubilden, vernünftige Touren zu planen, Quittierungen konsequent einzufordern und Zustellqualität zu kontrollieren. Der Konzern rechnet in Millionen Sendungen – ein paar Promille Verlust sind da schlicht „Reibung“. Für dich ist es jedes Mal 100 % Ärger.
Das Subunternehmer-Karussell verstärkt diesen Effekt. Wer billig anbietet, bekommt den Zuschlag; wer „zu langsam“ ist, wird ersetzt. Das erzeugt einen Dauerdruck nach unten: mehr Pakete pro Stunde, weniger Zeit pro Haustür, weniger Sorgfalt bei der Übergabe. Qualität ist in so einem Setup kein Wettbewerbsvorteil, sondern ein Kostenfaktor. Und wenn doch mal etwas auffällt, dreht sich das Karussell einfach weiter – neuer Vertragspartner, gleiche Regeln. Verantwortung verteilt sich so dünn, dass sie am Ende bei niemandem hängen bleibt.
Dazu passt die Oberfläche: hübsche Status-Seiten, Emojis für die Fahrer-Bewertung, Klickwege, die Lob mühelos einsammeln und Kritik versanden lassen. Wer „Es war toll“ drückt, ist in drei Sekunden fertig. Wer „Ich habe das Paket nicht erhalten“ wählt, landet gern auf einer „Schade“-Seite und darf sich selbst zum Support durchklicken. Auch das ist Kostensteuerung: Positives Feedback wird friktionslos, Problemfälle werden mit Reibung belegt. Nicht um sie zu lösen, sondern um sie zu reduzieren – statistisch.
Dass seit Corona die Unterschrift als Nachweis abgeschafft wurde, ist in diesem Modell kein Bug, sondern ein Feature. Ein echtes Übergabe-Protokoll kostet Zeit, und Zeit ist Geld. Ein Foto von irgendeinem Paket auf irgendeiner Fußmatte kostet nur eine Sekunde – und trifft die KPI. Juristisch trägt weiterhin der Verkäufer das Risiko bis zur tatsächlichen Übergabe; wirtschaftlich lohnt es sich trotzdem, die Nachweise zu verwässern, weil die Ersparnis im Tagesgeschäft größer ist als der spätere Aufwand für Ersatzsendungen. So entsteht eine Ökonomie der Schein-Nachweise: Hauptsache, im System leuchtet der Haken.
Die Rechnung bezahlen andere. Du bezahlst mit Zeit, Telefonaten, Fristen, Nerven. Händler bezahlen mit Margen, weil Ersatz und Rückerstattung am Ende bei ihnen ankommen – besonders im Marketplace. Die Fahrer bezahlen mit Gesundheit und Motivation, weil sie in Touren gepresst werden, die nur funktionieren, wenn man Regeln biegt. Und ja, es gibt viele Zusteller, die trotz allem korrekt arbeiten. Aber ein System, das nur dann rund läuft, wenn Einzelne übermenschlich funktionieren, ist kein gutes System – es ist ein Verschleißprogramm.
Die bittere Pointe: Amazon zeigt selbst, dass es anders ginge. Sobald der Warenwert steigt, wird auf einmal sorgfältig gearbeitet: Einmalpasswort, formelle Übergabe, strengere Dokumentation. Wenn Zuverlässigkeit also wichtig genug ist, ist sie plötzlich machbar. Für den Rest bleibt „billig“ das Leitprinzip – und das Ergebnis sieht man an jeder „zugestellten“ Sendung, die niemand gesehen hat.
Solange dieser Kosten-über-Qualität-Ansatz ungestört bleibt, ändert sich wenig. Freiwillig wird hier niemand die Schraube lockern; wozu auch, wenn die Kennzahlen stimmen und die Verluste einkalkuliert sind? Erst wenn aus eingepreisten Ausnahmen ein politisches Problem wird – sprich: klare Pflichten, echte Nachweise, spürbare Sanktionen –, verschiebt sich die Balance. Bis dahin gilt: Der Preis pro Paket ist beeindruckend niedrig. Der Preis für Zuverlässigkeit zahlst du.
Doppelte Standards: Billigware vs. teure Artikel
Wenn du bei Amazon ein Kabel für 5 Euro bestellst, ist die Zustellung oft ein Glücksspiel: mal liegt es irgendwo im Hausflur, mal beim „Hausbewohner“, mal auf einer fremden Fußmatte. Hauptsache, der Scanner sagt „zugestellt“. Verloren? Egal, dann gibt’s Ersatz. Niemand verliert dabei wirklich den Schlaf – außer du, wenn du das Teil eigentlich dringend gebraucht hättest.
Ganz anders sieht es aus, sobald es um hochpreisige Ware geht. Bestellst du ein Smartphone oder einen Laptop, taucht plötzlich ein ganz neues Gesicht der Logistik auf. Da wird nicht mehr „irgendwo abgelegt“, sondern auf einmal gibt es Zustellcodes per SMS, eine persönliche Übergabe mit Ausweis, manchmal sogar separate Kurierdienste. Plötzlich geht, was bei der Billigsendung angeblich unmöglich war: echte Sicherheit und echte Nachvollziehbarkeit.
Das zeigt: Amazon kann zuverlässig, wenn sie wollen. Nur offenbar nicht bei allem – sondern dort, wo es ihnen wirklich weh tun würde, wenn es verloren geht. Der Rest läuft weiter nach dem Prinzip „billig, schnell, egal“. Ein doppelter Standard, der offenlegt, worum es wirklich geht: nicht um dich als Kunde, sondern um den Wert der Ware und den möglichen Schaden für den Konzern.
Billigartikel: Hauptsache weg
Bei Kleinkram zeigt Amazon sein wahres Gesicht. Bestellst du das Ladekabel, den USB-Stick, die Batterien oder die Seifenpumpen-Kartusche, läuft die Zustellung nach dem Prinzip „Hauptsache weg“. Kein Einmalpasswort, keine echte Übergabe, meist nicht mal ein Klingeln. Der Fahrer hält kurz an, legt das Päckchen irgendwo ab, tippt „zugestellt“ in den Scanner und ist schon wieder verschwunden. Fürs System ist der Auftrag erledigt, für dich beginnt das Rätselraten. Manchmal taucht ein Foto in der App auf – irgendein Paket auf irgendeiner Fußmatte –, manchmal nicht einmal das. Und falls du das Paket tatsächlich findest, liegt es gern dort, wo es jeder mitnehmen könnte, der zufällig vorbeikommt.
Weil der Warenwert niedrig ist, kalkuliert Amazon das Risiko einfach ein. Verloren? Dann eben Erstattung. Beschädigt? Egal, schick’s zurück. In der Summe ist das billiger, als die Zustellung zuverlässig zu machen. Für dich klingt das im ersten Moment kundenfreundlich – bis du merkst, dass du jedes Mal Zeit zahlst: nachschauen, nachfragen, warten, Support suchen. Die Fehlerquote ist Teil des Modells, nicht dessen Ausrutscher. Und weil es um einen Fünf-Euro-Artikel geht, sollst du es am besten gar nicht weiter ernst nehmen.
Bei Marketplace-Bestellungen ist die Bequemlichkeit doppelt praktisch – aber nur für Amazon. Ersatzlieferung? Gibt’s häufig nur, wenn Amazon selbst verkauft. Sonst heißt es: „Erstattung veranlasst, bitte neu bestellen.“ Du darfst dich also wieder durch den Bestellprozess klicken, eventuell einen höheren Preis schlucken und erneut hoffen, dass diesmal jemand klingelt. Der Händler verliert den Umsatz, du die Zeit – das System bleibt ungestört. Und wenn die Lieferung beim zweiten Mal wieder im Nirwana landet, beginnt das Spiel von vorn.
Selbst die Rückmeldung ist so designt, dass sie keine Arbeit macht: „Wie war die Zustellung?“ – Daumen hoch oder runter. Klickst du auf „war nicht so toll“ und wählst „Paket nicht erhalten“, bekommst du einen höflichen Textbaustein und darfst dich anschließend selbst zum Support durchhangeln. Lob fließt friktionslos ins System, Kritik wird mit Reibung versehen. Das Ergebnis: glänzende Kennzahlen, wenig Veränderung.
Auffällig ist, wie leichtfertig man bei Billigartikeln mit Nachweisen umgeht. Eine Unterschrift? Fehlanzeige. Ein Name beim angeblichen „Hausbewohner“? Seit Jahren nicht mehr. Ein Foto, das beweist, dass es wirklich dein Paket war? Meist absichtlich so gerahmt, dass man weder Adresse noch Aufkleber erkennt. Das reicht, um intern „erfolgreich zugestellt“ zu verbuchen – und genau darum geht es. Nicht um deinen Besitz, sondern um den Haken in der Statistik.
Das eigentlich Bittere: Viele Zusteller geben sich Mühe und liefern korrekt, aber das System belohnt Schnelligkeit, nicht Sorgfalt. Wer klingelt, wartet und sauber übergibt, verliert gegen den Kollegen, der fünf Türen weiter schon den nächsten „Zugestellt“-Scan produziert. Bei Kleinsendungen ist die Versuchung am größten, weil der Ärger statistisch klein bleibt und die Kulanzkosten durchrutschen. Für dich bedeutet das, dass ausgerechnet die Dinge, die du „mal eben schnell“ brauchst, am häufigsten zum Zeitfresser werden.
Unterm Strich ist die Botschaft eindeutig: Bei Billigartikeln zählt nicht, dass du sie bekommst, sondern dass sie aus dem Wagen sind. „Hauptsache weg“ ist die stille Leitlinie. Und solange du dich mit Erstattung zufriedengibst und neu bestellst, bleibt sie es auch.
Teure Ware: plötzlich streng geregelt
Sobald der Warenwert steigt, ändert Amazon die Spielregeln – schlagartig. Was beim 5-Euro-Kabel „irgendwie zugestellt“ heißt, wird beim Smartphone, bei der Grafikkarte oder bei deiner M.2-SSD plötzlich zur Hochsicherheitszone. Auf einmal gibt es Einmalpasswörter (OTP) per E-Mail oder SMS, die du dem Zusteller nennen musst, bevor das Paket den Wagen verlässt. Auf einmal wird wirklich geklingelt, und „Abstellen vor der Tür“ ist tabu. Und ja: Das passiert nicht erst ab 500 €, oft schon deutlich darunter – deine SSD um ~340 € ist das beste Beispiel.
Der Ablauf wirkt dann wie aus einem anderen Universum: Der Fahrer kommt, nennt den Namen, du nennst den OTP-Code, Empfang bestätigt, Thema durch. Kein „Hausbewohner“, kein mysteriöses Foto von einer fremden Fußmatte, kein „48 Stunden warten“. Bei manchen Sendungen wird zusätzlich der Ausweis abgeglichen oder es gibt Einschränkungen bei der Zustellart (keine Nachbarschaft, keine „Abstellgenehmigung“). Plötzlich gelten die Grundregeln sauberer Zustellung – exakt jene, die bei Billigartikeln angeblich „nicht praktikabel“ sind.
Warum? Weil der Risikoschaden hier weh tut. Teure Elektronik ist klein, leicht weiterzuverkaufen und diebstahlanfällig. Also greift Amazon zu Risikosteuerung: OTP für klare Übergabe, restriktive Zustellregeln, in der Praxis oft auch zuverlässigere Touren. Man sieht es in der Realität: Bei höherwertigen Sendungen stehen auf einmal Zusteller vor der Tür, die die Prozedur ernst nehmen – nicht, weil sie es plötzlich lieben, länger zu warten, sondern weil die internen Vorgaben und Kontrollen hier deutlich schärfer sind.
Für dich als Kunde ist das erst mal gut – hier funktioniert Zustellung so, wie sie überall funktionieren sollte. Kein Wegwerf-Scan, kein Rätselraten, wer „Hausbewohner“ sein könnte. Gleichzeitig entlarvt genau das den doppelten Standard: Amazon weiß, dass das normale Verfahren unsicher ist. Sonst bräuchte es bei teuren Artikeln keine Extrastufe mit Code, Ident-Check und „keine Ablage“. Der Konzern gibt damit indirekt zu, dass die lässige Billig-Zustellung kein Qualitäts-, sondern ein Kostenproblem ist.
Spannend wird es, sobald der Händler nicht Amazon selbst ist. „Ersatzlieferung“ gibt es typischerweise nur, wenn Amazon Verkäufer ist. Bei Marketplace-Artikeln landest du oft bei „Erstattung, bitte neu bestellen“. Für dich bedeutet das: Geld kommt zurück (hoffentlich zügig), Artikel erneut suchen, erneut bestellen – und erneut hoffen, dass die Zustellung diesmal in die „teure-Ware-Logik“ fällt. Für den Händler bedeutet es Umsatzverlust; für Amazon ist es praktisch: Du bleibst im Ökosystem, der Ärger verschwindet in einer Rückbuchung.
Die Diskrepanz zeigt sich auch im Umgang mit Nachweisen. Beim 300-€-Artikel ist ein reiner Foto-„Beweis“ plötzlich keiner mehr; ohne Code keine Übergabe. Bei Kleinsendungen reicht dasselbe Foto als „alles erledigt“. Beim teuren Gerät ist Nachverfolgung auf einmal möglich, der Fahrer kann sich erinnern, die Route ist „plötzlich“ dokumentiert, und der Support weiß, was zu tun ist. Bei Billigartikeln liest du dagegen die Standardlitanei: „Bitte Adresse prüfen, Nachbarn fragen, 48 Stunden warten.“
Kurz gesagt: Wo es Amazon schmerzt, funktioniert es. Wo es egal ist, bleibt es egal. Das ist die eigentliche Pointe der doppelten Standards. Es beweist, dass verlässliche Zustellung kein Hexenwerk ist – sie kostet nur Zeit und Geld. Und beides investiert Amazon erst, wenn der Warenwert das rechtfertigt. Für dich als Kunde heißt das: Je teurer die Sendung, desto eher bekommst du die Zustellqualität, die eigentlich jedes Paket verdient hätte.
Das „tolle“ Bewertungssystem
Amazon liebt einfache Lösungen – und manchmal sind sie so simpel, dass sie schon wieder grotesk wirken. Ein Paradebeispiel dafür ist das Bewertungssystem für die Zustellung. Du bekommst in der App oder im Browser genau zwei Wahlmöglichkeiten vorgesetzt: „👍 Es war toll“ oder „👎 Es war nicht so toll“. Mehr Graustufen gibt es nicht. Entweder war deine Lieferung angeblich ein Traum – oder eben ein Desaster. Dazwischen existiert nichts.
Klickst du auf „Es war toll“, wirst du geradezu überschüttet mit Auswahlfeldern. Da kannst du ankreuzen, wie pünktlich, freundlich und rücksichtsvoll der Zusteller war, ob er vielleicht noch einen Blumenstrauß überreicht hat oder die Treppen im Hausflur besonders leise genommen hat. Alles ist darauf ausgerichtet, möglichst schnell positive Daten einzusammeln, damit Amazon seine Statistik füttern kann. Ein paar Klicks, fertig – der Fahrer glänzt, die Quote stimmt, und das System meldet stolz: Kundenzufriedenheit erfüllt.
Doch wehe, du entscheidest dich für „Es war nicht so toll“. Dann öffnet sich kein schnelles Beschwerdeformular, keine praktische Schaltfläche zum direkten Kundenservice, sondern ein Katalog vordefinierter Standardantworten. Eine davon lautet „Ich habe das Paket nicht erhalten“. Klingt nach einem ernsthaften Problem, sollte man meinen – immerhin geht es um eine Lieferung, die offiziell zugestellt wurde, in Wahrheit aber nie bei dir angekommen ist. Und was passiert, wenn du diese Option auswählst? Statt Hilfe oder Lösung wirst du auf eine Textseite umgeleitet, die nichts anderes sagt als: „Schade.“ Ein paar Zeilen Bedauern, vielleicht noch ein Hinweis auf die Hilfeseiten – und das war’s. Dein Problem bleibt ungelöst.
Das System ist so gebaut, dass Lob sofort erfasst und weiterverarbeitet wird, während Kritik praktisch ins Leere läuft. Positives Feedback bringt Punkte für den Zusteller, verbessert interne Kennzahlen und gibt Amazon die Möglichkeit, mit „zufriedenen Kunden“ zu werben. Negatives Feedback hingegen wird weichgespült, abgebogen und in endlosen Klickketten versteckt, bis du am Ende genervt aufgibst – oder dich mühsam selbst durch die Seiten des Kundenservice gekämpft hast.
Und hier liegt der eigentliche Zynismus: Anstatt Kritik ernst zu nehmen, macht Amazon dir den Weg bewusst schwer. Während ein Lob für den Fahrer mit zwei Klicks erledigt ist, musst du für eine ernsthafte Reklamation mehrere Hürden überwinden, dich durch Untermenüs hangeln und am Ende selbst den Support suchen. Hilfe gibt es nicht dort, wo sie am dringendsten gebraucht würde, sondern nur, wenn du hartnäckig genug bist, die richtigen Schaltflächen aufzuspüren.
Dieses Bewertungssystem ist daher kein Instrument, um echte Kundenerfahrungen widerzuspiegeln, sondern ein Schönfärbe-Werkzeug. Es sorgt für glänzende Statistiken, blendet die Realität aber aus. Denn während die Zahlen zeigen, dass „alles super läuft“, sitzen draußen unzählige Kunden, deren Pakete verschwunden sind, die nur eine hohle Standardantwort erhalten und denen man suggeriert: „Es liegt nicht an uns, du musst dich nur besser umsehen.“
Kurz gesagt: Amazons Zustellbewertung ist kein Werkzeug für Transparenz, sondern ein Filter, der positive Erfahrungen nach oben spült und negative so weit verdünnt, dass sie im System praktisch unsichtbar werden. Für dich bedeutet das: viel Klickerei, viel Ärger und am Ende keine echte Hilfe. Für Amazon bedeutet es: ein schönes Dashboard mit tollen Zahlen – und der Schein, alles laufe reibungslos.
Kundenservice à la Amazon
Den Kundenservice bei Amazon zu finden, ist eine eigene Disziplin. Auf der Seite selbst wirkt Hilfe wie ein Easter Egg: gut versteckt, mehrere Klicks tief, versehen mit Formularen, die eher deine Geduld testen als dein Problem lösen. Ironischerweise kommst du schneller ans Ziel, wenn du Google bemühst. Damit du nicht suchen musst: Der Chat sitzt hier → https://www.amazon.de/hz/contact-us/foresight/hubgateway und der Rückrufservice hier → https://www.amazon.de/gp/help/customer/ces/phone-popup.html. Beides funktioniert – aber nicht immer gleich gut.
Im Chat merkst du sofort, wie durchgetaktet das System ist. Vordefinierte Antworten, Auswahlknöpfe, klare Pfade. Für einfache Fälle reicht das; für „zugestellt, aber nicht erhalten“ oft nicht. Du klickst „Paket nicht erhalten“, bekommst Standardtexte und landest am Ende doch wieder bei der Empfehlung, erst mal 48 Stunden zu warten oder bei Nachbarn zu fragen. Das ist bequeme Prozesspflege: Dein Ärger wird erfasst, aber nicht automatisch in eine Lösung überführt. Hilfreich wird der Chat erst, wenn du aus der Schablone ausbrichst – kurz, bestimmt, mit der klaren Forderung nach Ersatzlieferung oder Rückzahlung. Dann gibt es meist eine Fallnummer, manchmal auch die Zusage, dass intern „ermittelt“ wird. Erfahrungsgemäß bedeutet das: Es passiert vor allem eins – Zeit vergeht.
Der Rückrufservice wirkt persönlicher: Du trägst deine Nummer ein, wirst angerufen, schilderst dein Problem. Hier entscheidet die Person am anderen Ende über Tempo und Qualität der Lösung. Es kann sehr gut laufen – oder zäh werden. Viele berichten, was du selbst erlebt hast: Sprachbarrieren machen das Gespräch anstrengender als nötig. Das liegt nicht an der Leitung, sondern am Personal. Wenn du kaum etwas verstehst, sag das ruhig und bitte freundlich um Weiterleitung an jemanden mit besseren Deutschkenntnissen; das ist keine Unverschämtheit, sondern Voraussetzung dafür, dass dein Anliegen korrekt aufgenommen wird. Und bleib bei der Sache: „Status zeigt zugestellt, Ware nicht erhalten. Bitte Ersatzlieferung bis [Datum] oder Rückzahlung.“ Alles andere führt dich wieder in Warteschleifen.
Gemeinsam haben Chat und Rückruf, dass sie den Fall gern noch einmal „technisch prüfen“ – Zusteller anfragen, Fotos sichten, Status vergleichen. Klingt nach Ermittlungsarbeit, ist in der Praxis meist ein Placebo. Wenn ein Paket verschwunden ist, taucht es selten wieder auf, nur weil intern jemand eine Mail an den Fahrer schickt. Wichtig ist, dass du dir sofort eine Fallnummer geben lässt und die Frist benennst, bis wann du eine Lösung erwartest. Lass dich nicht auf ein Ping-Pong zwischen Amazon und Marketplace-Händler ein, wenn „Versand durch Amazon“ dahintersteht; die Logistik liegt dann bei Amazon, und genau dort gehört dein Fall hin. Wird dir stattdessen geraten, du mögest dich an das Transportunternehmen wenden, bleib freundlich, aber klar: Dein Vertrag besteht mit dem Verkäufer, nicht mit dem Zusteller – und der Verkäufer schuldet die Lieferung, nicht du die Spurensuche.
Auffällig ist, wie wenig der Support mit anderen Systemen vernetzt ist. Du bekommst Bewertungs-Mails zur „gelungenen“ Zustellung, während dein Reklamationsfall noch offen ist; im Chat klickst du „nicht erhalten“, wirst aber nicht automatisch zu einer Lösungsstrecke geführt; im Rückruf erklärst du alles von vorn, obwohl du gestern schon eine Fallnummer bekommen hast. Diese Entkopplung ist kein Zufall, sie spart Arbeit – bei Amazon, nicht bei dir. Deshalb lohnt es sich, deine Belege parat zu haben: Screenshot der Sendungsverfolgung („zugestellt“), Datum und Zeit, kurz notiert, dass niemand geklingelt hat und kein Ablageort vereinbart war. Du musst keinen Roman erzählen; zwei Sätze mit Fakten sind stärker als zehn mit Vermutungen.
Wenn der Artikel direkt von Amazon verkauft wurde, ist die Ersatzlieferung oft nur eine Frage des richtigen Knopfdrucks – und genau den musst du im Gespräch erzwingen. Wenn es ein Marketplace-Artikel ist, versucht Amazon dich gern in die Schiene „Erstattung, bitte neu bestellen“ zu lenken. Das kann okay sein, ist aber nicht alternativlos: Besteh bei dringenden Dingen auf Ersatz, wenn der Artikel noch verfügbar ist. Denn eine Erstattung löst dein Problem nicht, sie verschiebt es nur – du bestellst erneut, zahlst vielleicht mehr und hoffst, dass diesmal jemand klingelt.
Kurz gesagt: Amazons Kundenservice ist kein Ort, an dem Probleme automatisch verschwinden; er ist ein Ort, an dem Probleme geordnet verschwinden sollen. Du bekommst Hilfe – wenn du sie aktiv einforderst, klar bleibst und dir nicht den Ball zuspielen lässt. Nimm den direkten Weg (Chat oder Rückruf über die Links oben), sichere dir eine Fallnummer, setz ein Datum, bleib freundlich, aber bestimmt. Dann wird aus dem „Schade“-Text eine tatsächliche Lösung – nicht, weil das System so gut ist, sondern weil du es dazu zwingst.
Andere Paketdienste: Auch kein Ruhmesblatt
So bequem es wäre, das Zustellchaos allein bei Amazon abzuladen – fair wäre es nicht. Denn auch die klassischen Paketdienste wie DHL, Hermes, DPD oder GLS liefern seit Jahren reichlich Stoff für Frust. Mal heißt es „Empfänger nicht angetroffen“, obwohl du den ganzen Tag zu Hause warst. Mal steckt eine Benachrichtigungskarte im Briefkasten, die dich zu einer kilometerweiten Fahrt in irgendeine Packstation oder einen Kiosk zwingt – obwohl der Fahrer nie geklingelt hat. Und manchmal liegt dein Paket einfach irgendwo im Hausflur, frei für alle, die zufällig vorbeikommen.
Die Unterschiede zwischen den Diensten sind dabei eher Nuancen. Jeder hat seine Eigenheiten, seine Standard-Ausreden und seine Spezialmethoden, Pakete loszuwerden. Aber eines verbindet sie: Verlässlichkeit sieht anders aus. Stattdessen werden Zustellungen zu einer Art Glücksspiel, bei dem du mitfieberst, ob dein Paket tatsächlich den Weg zu dir findet – oder im Nirgendwo landet.
Anders gesagt: Auch jenseits von Amazon glänzt die Branche nicht gerade mit Servicequalität. Was wir im nächsten Abschnitt sehen, ist kein Einzelfall, sondern ein branchenweites Problem.
GLS: Fantasie-Ausreden und Paketshop-Standard
Wenn es einen Paketdienst gibt, der für kreative Ausreden beinahe ein eigenes Wörterbuch schreiben könnte, dann ist es GLS. Wer öfter dort bestellt, kennt das Spiel: In der App oder in der Sendungsverfolgung erscheinen Meldungen, die mehr nach Märchenbuch als nach Realität klingen. Statt eines echten Zustellversuchs hagelt es Notizen wie „Empfänger nicht angetroffen“ – selbst wenn du nachweislich den ganzen Tag zuhause warst.
Doch GLS wäre nicht GLS, wenn es bei dieser Standardlüge bleiben würde. Hier wird gerne improvisiert. Besonders beliebt ist zum Beispiel die Meldung: „Zustellung nicht möglich, Gefahr durch Hund.“ Klingt dramatisch, fast so, als hätte der Fahrer gerade sein Leben riskiert, während ein ausgewachsener Rottweiler oder gleich ein Wolfsrudel das Grundstück verteidigt. Die Realität sieht oft etwas anders aus: Da stehen angeleinte kleine Hunde vor der Haustür – und manchmal sind die Viecher, die GLS angeblich in Panik versetzen, kaum größer als eine ausgewachsene Ratte. Von „Gefahr“ kann da keine Rede sein. Aber für den Fahrer ist es praktisch: Mit so einer Begründung kann man die Zustellung abbrechen, ohne jemals wirklich geklingelt oder einen Schritt vor die Tür gesetzt zu haben.
Noch ein Klassiker: „Zugang nicht möglich“ oder „Empfängeradresse unklar“. Da stehst du dann vor deinem eigenen Haus, mit einem fetten Klingelschild, eindeutig lesbarer Hausnummer und denkst dir: Wie viel unklarer soll es eigentlich noch werden? Aber für GLS reicht schon ein halbherziger Blick aus dem Auto, um zu behaupten: „Adresse nicht gefunden.“ Zack, Problem gelöst – aus Sicht des Fahrers jedenfalls.
Und dann gibt es die Königsdisziplin: den automatischen Paketshop-Trick. Während andere Dienste zumindest so tun, als hätten sie versucht zuzustellen, hat GLS längst ein eigenes System etabliert: Die Sendungen landen direkt im Paketshop, ganz ohne dass jemand geklingelt oder überhaupt am Haus vorbeigefahren ist. Besonders dreist ist, dass du in der Sendungsverfolgung oft gar keine klare Information bekommst. Da steht nicht: „Paket im Paketshop hinterlegt.“ Nein, meistens bleibt der Status vage, vielleicht ein Hinweis auf „Zustellung nicht möglich“. Erst wenn du selbst aktiv wirst, bei GLS anrufst oder auf Verdacht im Paketshop nachfragst, erfährst du, dass dein Paket längst dort liegt – manchmal schon seit Stunden.
Und genau das ist das Problem: GLS hat den Paketshop faktisch zum Standard erklärt. Die eigentliche Haustürzustellung ist eher die Ausnahme. Für den Fahrer ist das bequem: Alles in einem Schwung beim Shop abladen, fertig. Keine Klingeln, keine Diskussionen mit Kunden, keine „Hindernisse“ wie angebliche Hunde. Für dich als Empfänger bedeutet das aber: zusätzlicher Aufwand, extra Wege, verpasste Lieferungen – und das alles, obwohl du ja eigentlich für die Zustellung nach Hause bezahlt hast.
Dass GLS damit durchkommt, liegt wie immer am Preis. Billiger Transport bedeutet weniger Zeit pro Paket, weniger Lust auf echte Zustellversuche und mehr Ausreden im Tracking. Der Kunde bleibt zurück mit Frust, verpassten Lieferungen und dem Gefühl, einer Lotterie beizutreten, sobald der Absender „GLS“ auf das Etikett klebt.
Kurz gesagt: Wer bei GLS bestellt, braucht starke Nerven, Humor und manchmal auch eine Lupe, um die Realität hinter den „Gefahr-durch-Hund“-Meldungen zu erkennen. Denn oft sind die angeblichen Bestien nicht größer als ein Nager – aber für GLS reicht’s, um ein Paket gar nicht erst abzuliefern.
Hermes: immerhin wieder mit Unterschrift
Man glaubt es kaum: Ausgerechnet Hermes – jahrelang als Synonym für Chaos, ewige Lieferzeiten und zweifelhafte Servicequalität verschrien – schafft es inzwischen, in einem entscheidenden Punkt positiv hervorzustechen. Während Amazon, DHL oder GLS mit Fantasie-Meldungen, Abstellgenehmigungen und Foto-Beweisen jonglieren, macht Hermes etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte: Sie bestehen wieder auf einer Unterschrift.
Ja, richtig gelesen – dieser kleine, altmodische Kritzelhaken, den man mit dem Finger auf einem Scanner zieht, sorgt plötzlich für mehr Transparenz und Sicherheit als so ziemlich jedes „moderne“ System der Konkurrenz. Klingt banal, ist es aber nicht. Denn mit der Unterschrift ist klar dokumentiert, dass eine Übergabe tatsächlich stattgefunden hat. Kein nebulöses „Hausbewohner“, kein „Foto von irgendeiner Fußmatte“, sondern: Empfänger angetroffen, Paket persönlich übergeben.
Und das funktioniert erstaunlich zuverlässig. In der Praxis bedeutet es: Wenn Hermes ein Paket bringt, hast du es auch in der Hand. Keine Rätselraten, ob es beim Nachbarn liegt, keine Schnitzeljagd durch Paketshops und keine 48-Stunden-Warteschleife nach dem Motto „Vielleicht taucht es ja noch auf“. Stattdessen klingelt es, du öffnest die Tür, unterschreibst – und die Sache ist erledigt. Genau so, wie es eigentlich überall sein sollte.
Natürlich, Hermes ist nicht über Nacht zum Premium-Dienst mutiert. Die Lieferzeiten sind manchmal immer noch länger als bei anderen, und der Ruf aus den vergangenen Jahren hängt ihnen nach. Aber wenn es um die eigentliche Zustellung geht, machen sie aktuell vieles richtig. Gerade im Vergleich zu Amazon-Logistics oder GLS wirkt Hermes fast schon wie ein Fels in der Brandung: keine dubiosen Statusmeldungen, keine willkürlichen Ablagen, sondern eine Zustellung, die den Namen verdient.
Interessant ist, dass Hermes mit dieser „altmodischen“ Methode etwas geschafft hat, was die anderen mit all ihren angeblich modernen Prozessen nicht mehr hinbekommen: Vertrauen. Wenn du weißt, dass du unterschreiben musst, kannst du dich darauf verlassen, dass dein Paket auch wirklich bei dir ankommt – und nicht in irgendeinem Treppenhaus verschwindet. Und selbst wenn einmal ein Nachbar annimmt, steht dessen Name in der Sendungsverfolgung. Ganz simpel, ganz transparent.
Das Ergebnis: Hermes ist zwar immer noch kein Vorzeigeunternehmen, aber im direkten Vergleich haben sie sich einen unerwarteten Pluspunkt verdient. Während die Konkurrenz Zustellungen als optionalen Vorschlag versteht, hält Hermes am Grundprinzip fest: Ein Paket wird übergeben, quittiert und dokumentiert. Punkt.
Man könnte fast sagen: In einer Branche, die sich immer weiter vom Kunden entfernt, sorgt Hermes dafür, dass Zustellung wieder das ist, was sie sein sollte – ein Paket in deiner Hand, bestätigt durch deine Unterschrift. Und genau das macht sie, trotz aller Schwächen, derzeit zur angenehmsten Überraschung unter den Paketdiensten.
DHL: Mal klingelt keiner, bald vielleicht auch keine Filiale mehr
DHL ist immer noch der Platzhirsch – und viele vertrauen darauf, dass es „mit den Gelben“ schon am zuverlässigsten läuft. Komplett falsch ist das nicht, aber die glänzende Fassade bekommt Risse. Ein Klassiker ist der angebliche „Zustellversuch“: In der Sendungsverfolgung heißt es, du wärst nicht zu Hause gewesen – obwohl du den ganzen Tag auf den Boten gewartet hast. Geklingelt hat niemand. Am Abend steckt dafür eine Benachrichtigungskarte im Briefkasten. Ohne diese Karte oder den Eintrag im System könntest du dein Paket in Filiale oder Packstation gar nicht abholen. Immerhin gibt es also einen offiziellen Nachweis – nur ersetzt er keine echte Zustellung.
Dann gibt es das große Versprechen vom Live-Tracking. Laut Anzeige ist der Zusteller „noch 6 Stopps entfernt“ und in einer Stunde bei dir. Nach einer halben Stunde: immer noch 6 Stopps. Noch eine halbe Stunde: „Live-Tracking derzeit nicht möglich.“ Zwei Stunden später klingelt es dann plötzlich doch. „Live“ ist das nicht – eher ein Rätselraten in Gelb.
Besonders ärgerlich ist die Sache mit den Paketshops und Packstationen. Natürlich sind sie praktisch, wenn du selbst bestimmen willst, wo deine Sendung hingeht. Nervig wird es aber, wenn gar nicht erst geklingelt wird und dein Paket direkt dort landet. Noch nerviger: Selbst wenn du am Nachmittag schon eine Benachrichtigung im Briefkasten hast oder die Info in der App siehst – abholen kannst du es meistens erst am nächsten Tag. Denn der Fahrer liefert die nicht zugestellten Pakete erst nach Ende seiner Tour oder am nächsten Morgen im Shop/der Packstation ein. Für dich heißt das: Du weißt, dass dein Paket „da“ ist, aber in Wirklichkeit liegt es noch irgendwo im Transporter.
Dazu kommt die Entwicklung bei der Filiallandschaft. Immer mehr klassische Postfilialen und kleine Partner-Shops schließen. Stattdessen setzt DHL fast ausschließlich auf Packstationen. Für manche Kunden mag das bequem sein, aber wer persönliche Beratung oder Service braucht, schaut in die Röhre. Ein Beispiel: In Aurich hat die Postfiliale dichtgemacht. Wer jetzt eine persönliche Beratung will, muss 35 Kilometer nach Leer fahren – nur um den Service zu bekommen, der früher direkt in der Stadt verfügbar war. Für den Konzern ist das effizient, für die Kunden schlicht unpraktisch.
So bleibt auch bei DHL der Eindruck: Es wirkt oft strukturierter als bei den schlimmsten Konkurrenten – aber auch hier wird der Service Schritt für Schritt zu einem Do-it-yourself-System umgebaut. Der Bote klingelt nicht immer, die „Live“-Verfolgung ist ein Glücksspiel, die Filialen verschwinden – und am Ende liegt die Arbeit wieder bei dir. Für DHL ist das effizient. Für dich bedeutet es: mehr Aufwand für eine Leistung, die eigentlich Zustellung heißen sollte.
Das Grundproblem: Keine Quittierung mehr
Eigentlich ist es ganz einfach: Ein Paket wird übergeben, du bestätigst mit deiner Unterschrift, und beide Seiten haben einen Nachweis. Klingt nach einem klaren, fairen System – und jahrzehntelang hat es auch genauso funktioniert. Heute hingegen hat sich das Ganze in Luft aufgelöst. Statt Unterschrift gibt es diffuse Statusmeldungen, verwackelte Fotos oder die pauschale Angabe „An Hausbewohner übergeben“. Was bleibt, ist ein Gefühl der völligen Unsicherheit: Ist mein Paket nun wirklich da, oder hat der Fahrer nur einen Haken in sein Gerät gesetzt, um schneller Feierabend zu machen?
Das eigentliche Problem liegt genau darin: Es gibt keine Quittierung mehr. Keine eindeutige Bestätigung, die zeigt, dass du das Paket tatsächlich entgegengenommen hast. Früher war dieser Prozess wasserdicht: Paketbote klingelt, du unterschreibst, fertig. Und wenn das Paket später verschwunden war, konnte man nachvollziehen, wer es entgegengenommen hat. Heute hingegen reicht ein Mausklick oder ein Fingertippen auf dem Scanner – schon ist die Sendung offiziell „zugestellt“.
Für die Paketdienste ist das praktisch. Weniger Aufwand, weniger Zeitverlust, keine Diskussionen mit Kunden, die nicht da sind oder die vielleicht zweimal klingeln lassen. Aber für dich als Empfänger ist es ein Desaster. Denn wenn die Quittierung fehlt, fehlt auch jede Nachvollziehbarkeit. Du stehst da, die App jubelt „erfolgreich zugestellt“, und du weißt: Du hast gar nichts bekommen. Im schlimmsten Fall landest du in einer Beweisfalle, denn der Zusteller sagt: „Im System steht zugestellt“ – und du kannst nur erwidern: „Aber bei mir ist nichts angekommen.“
Das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Probleme, die wir vorher beschrieben haben. Egal ob „Foto auf fremder Fußmatte“, „An Hausbewohner übergeben“ oder „Zugestellt ohne jeden Hinweis“ – alles läuft auf dasselbe hinaus: Es gibt keinen belastbaren Nachweis mehr. Die Verantwortung wird verschoben, der Empfänger bleibt im Regen stehen.
Man muss sich das mal vorstellen: Bei jeder banalen Paketabgabe – von Pizza über Blumen bis hin zu Medikamenten – wird dokumentiert, wer wann was übernommen hat. Nur bei den großen Versandriesen wie Amazon reicht inzwischen ein Klick, und alles ist „erledigt“. Das ist nicht nur absurd, es ist auch gefährlich. Denn solange keine echte Quittierung stattfindet, haben Betrug, Fehler und schlichtweg schlampige Zustellungen freie Bahn.
Dass es auch anders geht, zeigen die wenigen Anbieter, die wieder zur Unterschrift zurückgekehrt sind. Dort weiß man: Wenn du unterschreibst, dann bist du auch verantwortlich – und wenn du nicht unterschrieben hast, ist das Paket schlicht nicht zugestellt. Transparent, nachvollziehbar, fair. Genau das, was heute vielerorts fehlt.
Kurz gesagt: Das Grundproblem in der Paketwelt ist nicht die Technik, nicht die Menge an Sendungen und nicht einmal die Überlastung der Fahrer. Das Grundproblem ist das Fehlen eines verbindlichen Nachweises. Solange man Pakete „verschwinden lassen“ kann, ohne dass es Spuren gibt, wird sich am Zustellchaos nichts ändern. Erst wenn die Quittierung – in welcher Form auch immer – wieder Standard wird, gibt es eine echte Basis für Vertrauen. Alles andere ist eine Einladung zum Missbrauch.
Wer könnte es ändern?
Die eigentliche Frage lautet: Wer kann diesem Zustell-Chaos ein Ende bereiten? Die Paketdienste selbst? Wohl kaum. Solange es für sie billiger ist, Pakete irgendwo abzukippen und bei Problemen einfach Ersatz zu schicken, besteht null Anreiz, die Abläufe zu verbessern. Warum auch? Der Umsatz stimmt, der Kunde bekommt „irgendwann“ seine Ware – und wer sich beschwert, landet in einem Callcenter mit Textbausteinen.
Die Politik? Ja, theoretisch. Es wäre kein Hexenwerk, die gesetzlichen Vorgaben zu verschärfen. Zum Beispiel eine klare Pflicht zur Quittierung durch den Empfänger. Kein Fantasie-Status wie „Hausbewohner“ oder „Gefahr durch Hund“, sondern ein eindeutiger Nachweis mit Namen oder Unterschrift. Auch könnte man festlegen, dass Zustellfotos nur dann gelten, wenn die Adresse und der Empfänger eindeutig erkennbar sind. Doch stattdessen glänzt die Politik durch Untätigkeit. Ab und zu gibt es eine kleine Anfrage im Bundestag, vielleicht ein Statement über „die Bedeutung der Logistikbranche für die Wirtschaft“ – und das war’s. Konsequente Regeln? Fehlanzeige.
Die Verbraucherzentralen? Die sind im Prinzip da, um Missstände anzuprangern. Und ja, hier und da gibt es Warnungen oder Berichte über dubiose Zustellmethoden. Aber groß durchsetzen können sie nichts – höchstens mal ein Musterverfahren anstoßen oder bei besonders dreisten AGB der Paketdienste klagen. Im Alltag hilft das wenig. Bis da ein Urteil durch alle Instanzen gegangen ist, sind längst neue Tricks erfunden worden, die rechtlich noch nicht erfasst sind.
Die Gerichte? Im Einzelfall: ja. Wenn du dein Paket nicht bekommst und klagst, dann ist die Rechtslage eindeutig – der Verkäufer bleibt verantwortlich, bis du die Ware wirklich in den Händen hältst. Das Problem: Kaum jemand verklagt Amazon oder DHL wegen eines 20-Euro-Pakets. Und genau darauf setzen die Konzerne: Der Aufwand lohnt sich für dich nicht, also fügst du dich. Auf Masse gerechnet spart der Konzern Millionen – weil jeder Einzelne für sich genommen keine Chance hat, etwas zu bewegen.
Bleiben die Kunden selbst. Und genau hier liegt der Knackpunkt: Solange wir das Spiel mitspielen, solange wir uns mit Ersatzlieferungen und automatischen Erstattungen abspeisen lassen, solange wird sich nichts ändern. Für Amazon und Co. ist es billiger, die Verluste in Kauf zu nehmen, als die Zustellung wirklich zuverlässig zu machen. Erst wenn genug Leute sagen: „Nein, so nicht mehr“, und die Beschwerden nicht nur im Chatfenster landen, sondern bei Aufsichtsbehörden, Verbraucherschutz oder notfalls auch bei der Presse, könnte Druck entstehen.
Aber machen wir uns nichts vor: Die allermeisten zucken mit den Schultern, ärgern sich kurz – und klicken dann wieder auf „Jetzt kaufen“. Genau darauf bauen die Konzerne. Sie wissen: Jeder Einzelfall ist ärgerlich, aber in der Masse funktioniert es trotzdem. So lange, bis die Kunden nicht mehr alles hinnehmen.
Fazit: Ändern könnte es die Politik, verschärfte Gesetze könnten Paketdienste in die Pflicht nehmen. Verbraucherzentralen und Gerichte könnten Druck machen. Am Ende aber hängt es auch an uns, den Kunden. Doch so lange sich der bequeme Reflex „Ach, Ersatz kommt ja sowieso“ hält, bleibt die Zustellung ein Glücksspiel – bei dem die Konzerne immer gewinnen.
Petition: Deine Stimme zählt
Es ist leicht, sich über verlorene oder falsch zugestellte Pakete aufzuregen. Aber solange die Politik untätig bleibt, ändert sich im Alltag nichts. Genau deshalb habe ich die Initiative ergriffen und beim Deutschen Bundestag eine offizielle Petition eingereicht. Darin fordere ich klare gesetzliche Regeln, die uns Verbraucher endlich besser schützen – und die Zusteller gleichzeitig zu einer sauberen Arbeitsweise verpflichten.
Kern der Petition ist die Rückkehr zu einer Selbstverständlichkeit: Der Zusteller soll verpflichtet sein, aktiv zu klingeln. Eine Paketlieferung darf nicht daran scheitern, dass es angeblich „keinen Zustellversuch“ gab oder dass der Fahrer einfach vorbeigefahren ist. Wenn geklingelt wurde und niemand öffnet, ist das etwas anderes – aber der Versuch muss nachweisbar stattfinden.
Ebenso wichtig ist die Empfangsbestätigung. Seit der Corona-Pandemie haben viele Dienste diese still und heimlich abgeschafft. Statt einer Unterschrift oder zumindest einer digitalen Bestätigung reicht heute oft ein Foto oder eine selbst vergebene Statusmeldung des Fahrers. Damit sind Manipulation und Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Die Petition fordert deshalb: Die Empfangsquittierung – ob digital oder klassisch per Unterschrift – muss wieder verpflichtend eingeführt werden. Nur so hat der Empfänger einen echten Nachweis, dass er die Sendung erhalten hat.
Eine Zustellung ohne Bestätigung soll es nur dann geben dürfen, wenn der Empfänger vorher ausdrücklich eine Abstellgenehmigung erteilt hat, etwa: „Bitte ins Gartenhäuschen legen“ oder „auf der Terrasse abstellen“. Nur dann ist die Ablage rechtlich sauber. Alles andere – bloßes Vor-die-Tür-Stellen, Nachbarschaftsabgaben ohne Info oder ausgedachte Begründungen wie „Gefahr durch Hund“ – kann nicht länger als ordnungsgemäße Lieferung durchgehen.
Die Petition geht noch einen Schritt weiter: Falsche Statusmeldungen müssen sanktioniert werden. Wer behauptet, „Empfänger nicht angetroffen“, ohne überhaupt geklingelt zu haben, der darf nicht folgenlos davonkommen. Hier soll die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde mehr Befugnisse erhalten, um Verstöße zu prüfen und durchzugreifen. Nur mit klaren Strafen für wiederholte Täuschungen entsteht Druck auf die Paketdienste, ihre Abläufe tatsächlich zu verbessern.
Händler profitieren übrigens genauso wie Kunden: Denn auch sie leiden, wenn sie Rückzahlungen leisten müssen, obwohl die Zustellung schlicht schlampig war. Am Ende verlieren beide Seiten – nur die Paketdienste kommen bisher ungeschoren davon.
Mit dieser Petition möchte ich erreichen, dass aus dem Flickenteppich an Zustellregeln endlich ein verlässlicher Standard wird. Wenn die Forderungen umgesetzt werden, hätten wir wieder mehr Transparenz, Sicherheit und Vertrauen – und Paketzustellung würde das sein, was sie sein sollte: eine verlässliche Dienstleistung statt ein tägliches Glücksspiel.
Die Petition ist jetzt offiziell online!
Der Petitionsausschuss hat die Eingabe freigeschaltet — du kannst sie nun direkt auf der Website des Deutschen Bundestages mitzeichnen:
Petition 185319 – Zustellbedingungen für Paketdienste verschärfen
Die unten eingeblendete Version zeigt den ursprünglichen Petitionstext als Vorab-Scan.
Fazit: Zustellung darf kein Glücksspiel sein
Wenn ich heute ein Paket bestelle, weiß ich nie so genau, was mich erwartet. Bekomme ich es wirklich in die Hand gedrückt? Liegt es vor meiner Tür, frei zugänglich für jeden? Oder verschwindet es in irgendeinem Paketshop, ohne dass ich auch nur eine Benachrichtigung erhalte? Genau dieses Gefühl, dass jede Lieferung ein Glücksspiel ist, nervt mich am meisten.
Dabei geht es mir nicht um Kleinigkeiten. Ich erwarte keine rote Schleife um das Paket und auch keine persönliche Ansprache vom Zusteller. Aber ich erwarte, dass eine bezahlte Leistung zuverlässig erbracht wird. Eine Zustellung ist für mich erst dann erfüllt, wenn ich das Paket tatsächlich habe – und nicht dann, wenn irgendwo im System ein Haken gesetzt wurde.
Das Problem ist: Solange Konzerne wie Amazon und die Paketdienste es sich so leicht machen können, ändert sich nichts. Amazon ersetzt einfach die Ware oder erstattet das Geld. Für sie ist der Fall damit erledigt. Für mich bleibt der Ärger, die Zeitverschwendung und die Unsicherheit.
Noch schlimmer finde ich, dass diese Praxis inzwischen als „normal“ gilt. Wenn ein Paket verschwindet, heißt es: „Das passiert eben.“ Aber genau das darf nicht der Standard sein. Zustellung ist kein Glücksspiel und darf auch keines werden.
Für mich ist klar: Erst wenn Paketdienste wieder verpflichtet werden, eine ordentliche Quittierung zu leisten – sei es durch eine echte Unterschrift oder eine andere nachvollziehbare Bestätigung – kann ich als Empfänger sicher sein, dass meine Bestellung wirklich bei mir angekommen ist. Alles andere bleibt eine Einladung zum Chaos.
Darum sehe ich die Petition auch nicht als bloße Formalität, sondern als einen wichtigen Schritt. Ich will nicht länger akzeptieren, dass Zusteller frei entscheiden, wie ernst sie ihre Arbeit nehmen. Wenn ich etwas bezahle, will ich es auch bekommen – ohne Umwege, ohne Ausreden, ohne „vielleicht“.
Am Ende ist es ganz einfach: Zustellung bedeutet Übergabe. Und solange das nicht wieder selbstverständlich ist, bleibt jede Bestellung ein Würfelspiel.
Vielen Dank fürs Lesen
Wenn dir der Artikel gefallen hat oder du ähnliche Erfahrungen mit Amazon & Co. gemacht hast, freue ich mich über deinen Kommentar. Teile den Beitrag auch gerne über die Social-Media-Buttons unten – je mehr Aufmerksamkeit das Thema bekommt, desto größer der Druck, dass sich endlich etwas ändert.
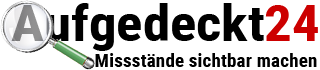




Nachtrag vom 22.08.2025:
Offenbar herrscht bei Amazon nicht nur in der Zustellung, sondern auch in der Verwaltung pures Chaos. Obwohl mir am 21.08.2025 um 19:21 Uhr per E-Mail mitgeteilt wurde, dass die Erstattung meiner letzten Bestellung gestoppt wird, war der Betrag zu diesem Zeitpunkt längst vollständig erstattet – 34,99 € auf mein Bankkonto und die bereits bei der Bestellung eingesetzten 10 € Guthaben wieder meinem Amazon-Konto gutgeschrieben. Da Überweisungen bei der Postbank nach 16 Uhr nicht mehr gebucht werden, muss die Erstattung also schon Stunden vor der E-Mail veranlasst worden sein.
Hinweis in eigener Sache:
Wenn dich dieses Thema genauso ärgert wie mich, kannst du jetzt etwas bewegen:
Die Petition ist inzwischen offiziell beim Deutschen Bundestag freigeschaltet.
Jede Stimme zählt — und je mehr Unterstützung sie bekommt, desto größer ist die Chance, dass sich wirklich etwas ändert.
👉 Hier geht’s direkt zur Petition
Vielen Dank an alle, die mitzeichnen und das Thema weitertragen! 💛